Dreivierteldeutscher unter Hitler
von Udo Rühl
1924 in der kleinen Stadt Soest/Westf. geboren, war ich 1933 neun Jahre alt; das Ende der Hitlerdiktatur erlebte ich als 21Jähriger. Meine ersten Lebensjahre fielen in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Inflation, die Besetzung des Rheinlandes durch französisches Militär, Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit: die Weimarer Demokratie hatte es schwer, unter so negativen Umständen im Volk Wurzeln zu schlagen. Die triumphale Politik der Siegermächte heizte den Nationalismus in den Köpfen der meisten Deutschen immer mehr an.
Mein Vater hatte als einfacher Soldat am Krieg teilgenommen und war in einem Unterstand an der Westfront verschüttet worden. Die Situation im Schützengraben hat er in einem Modell nachgebaut, so dass ich meine Spielzeugsoldaten in eine perfekte Kulisse stellen konnte. Eine Heizvorrichtung ermöglichte es, mit Hilfe von sogenannten Knalldöppchen Gewehrschüsse einschliesslich Pulvergeruch zu imitieren.
Neben den feldgrauen Soldaten hatte ich bei meinem Spielzeug auch andere: SA und SS-Männer. Einer trug eine flatternde Hakenkreuzfahne und Hitler persönlich war auch dabei. Den Hitlerarm konnte man zum Gruß nach oben biegen. So ließ ich dann die braunen Kolonnen am Führer vorbeimarschieren.
Mein Vater hatte eine schöne braune Uniform, bei der mir das Koppel und der Schulterriemen mit Karabinerhaken besonders imponierten und das Parteiabzeichen hatte er schon vor 1933. Er war „alter Kämpfer“, wie man damals sagte. Mein Vater war ein sehr gütiger Mensch. Er konnte, wie man so sagt, keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber er glaubte damals wie so viele, dass die braune Bewegung gut für Deutschland sei. Dafür im nachhinein Verständnis zu haben fällt mir schwer. Eher begreiflich ist mir auch heute noch die antikommunistische Einstellung meines Vaters. Er hatte an den Kämpfen gegen die Roten im Freikorps „Oberland“ in München teilgenommen.
Im Jahr 1930 kam ich in die evangelische Volksschule. Ich erinnere mich, dass so viele Mitschüler auf die wohl öfter gestellte Frage nach dem Beruf des Vaters „ arbeitslos“ antworteten. Ich erinnere mich an den Lehrer; der Rohrstock war sein regelmässig gebrauchtes Erziehungswerkszeug. Das Gebrüll, welches auf die Züchtigungen folgte (die Knaben bekamen's auf den Hosenboden, die Mädchen auf die Hand), war schrecklich. Ich selbst bin aber von solcher Tortur verschont geblieben, wohl weil ich dem Lehrer keinen Anlass dazu gegeben habe. Auch habe ich den Lehrer als durchaus gütigen Menschen in Erinnerung. Die mit dem Rohrstock erzwungene Ordnung ließ uns bei ihm eine Menge lernen: z. B. meine Kenntnisse in „ Heimatkunde“ stammen noch aus heutiger Erinnerung von ihm.
In der Turnstunde war gelegentlich „Stangenklettern“ dran. Dabei spielten Würste eine bedeutende Rolle. Bevor so eine Riege von Kindern die Stangen hinaufkletterte hatte der Lehrer über Seile die mitgebrachten (und von ihm auch wohl bezahlten), Würste so befestigt, dass er sie den Klettermaxen beim Klettern vor die Nase hielt und manchmal gelang es einem kleinen Turner, eine Wurst zu ergattern. Mir ist es nie gelungen; ich habe aber bald bemerkt, dass die mittels der Schnur geregelte Wurstzuteilung nicht nach sportlichen, sondern nach sozialen Gesichtspunkten erfolgte.
Ich erinnere mich noch heute an den 30. Januar 1933. Meine Eltern haben sich gefreut. Von jetzt an würde es ja aufwärts gehen. Am Abend waren wir zu Gast bei Bekannten, von deren Fenstern aus wir den Fackelzug der SA beobachteten. Es war eine fröhliche Stimmung. “ Wir“ hatten gewonnen, so kam es auch mir vor.
Die Hitlerjugend gab es schon. Für die zehn bis 14jährigen Jungen wurde das „Jungvolk“ gegründet. „Pimpfe“ hießen die Mitglieder. Selbstverständlich waren sie auch uniformiert: Braunhemd, schwarzes Halstuch, ganz kurze Cordhose, Koppelschloß, Schulterriemen mit Karabinerhaken, Fahrtenmesser (darauf stand „Blut und Ehre“, wenn ich mich richtig erinnere), eine schiffchenförmige Kopfbedeckung und für die kalte Jahreszeit eine dunkelblaue, kurze Jacke mit silberschimmernden Knöpfen. Da wollte ich dabei sein; allein schon wegen der Uniform! Und obwohl ich für die Aufnahme in das Jungvolk noch ein Jahr zu jung war, wurde ich akzeptiert.
Das Jungvolk, wie auch die Hitlerjugend, war militärisch organisiert. Der Kompanie entsprach das Fähnlein, dem der Fähnleinführer vorstand. Die als „Dienst“ bezeichneten Zusammenkünfte bestanden aus Exerzieren, „weltanschaulicher Schulung“ und

Körperertüchtigung. Auch Zeltlager standen auf dem Programm, mit Lagerfeuer, nächtlichem Wacheschieben und kriegerischen Spielen.
1934 kam ich auf die Oberrealschule. Von meiner Volksschulklasse wechselten nur drei Schüler auf eine weiterführende Schule. Von diesen war ich dann der einzige, der bis zum Abitur kam.
Irgendwann nahm ich den überall propagierten Antisemitismus wahr. Er war mir unverständlich. Ich habe meinen Vater danach befragt und der meinte, dass zu viele Juden in Schlüsselpositionen säßen und es gelte, deren Einfluss zurückzudrängen. Im übrigen glaubte er, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht würde. Wie er sich darin irrte, wurde alsbald offenbar.
In der Schule hatte ich einen jüdischen Schulkameraden; er hiess G. Lilienfeldt und hatte rote Haare. Eines Nachmittags traf ich ihn auf dem Marktplatz und sprach mit ihm. Da kam ein etwas älterer Hitlerjunge vorbei und schimpfte mit mir, dass ich, und dazu noch in Uniform, mit einem Juden spräche. Ich ließ mich einschüchtern, wandte mich von meinem Gesprächspartner ab und schämte mich zugleich meiner Feigheit; wohl aus diesem Grund erinnere ich mich noch so genau an die Szene. Der jüdische Mitschüler hat noch im Jahr 1934 die Schule verlassen müssen. Vor einigen Jahren erfuhr ich, daß er das „ tausendjährige Reich“ überlebt hat. Ich schrieb ihm und er antwortete sehr freundlich.
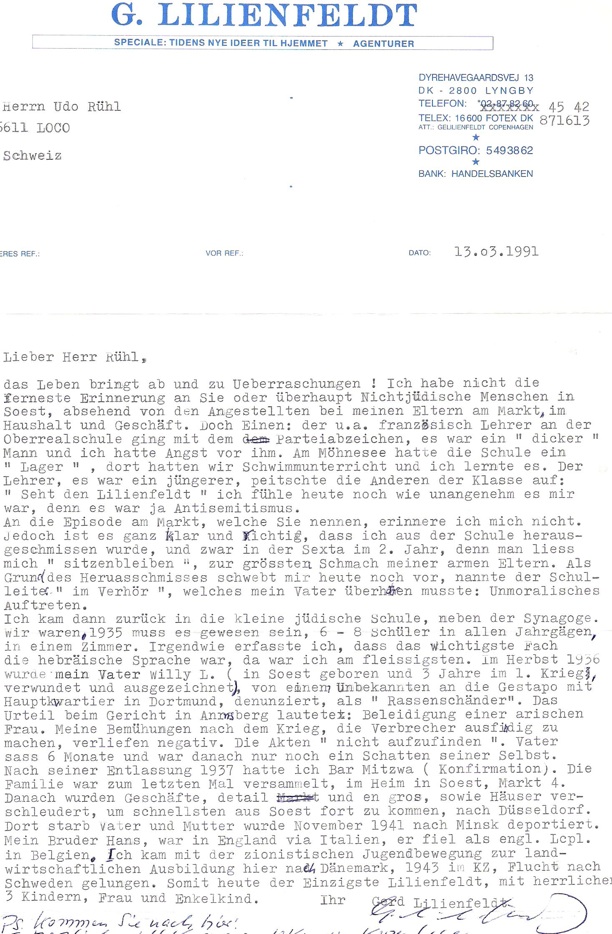
In den Parkanlagen der Stadt wurden Schilder aufgestellt, nach denen Juden der Aufenthalt dort verboten war. Eines Tages sprachen mich ein paar ausländische jugendliche Touristen an ich glaube, es waren Engländer und fragten, warum denn Juden den Park nicht aufsuchen durften. Ich wußte nicht, was ich antworten sollte. Es war mir peinlich. Dies ist wohl der Grund dafür, daß mir die Szene so deutlich in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, es war im Sommer 1934, als meine Eltern mit meiner Schwester und mir zwei Wochen Ferien in Berchtesgaden machten. Eines Tages hieß es: der Führer kommt auf den Obersalzberg. Eine große Menschenmenge bewegte sich auf der Straße an dem Reichskanzler vorbei und die Kinder durften vorkommen und Hitler die Hand drücken. Auch meine Schwester und ich haben dem Führer die Hand gegeben.
Eines Tages fragte mich ein älterer Hitlerjunge, was für eine Konfession meine Großmutter habe und er schien mit meiner Antwort auf die mir ganz unverständliche Frage, dass sie, wie die übrige Familie, evangelisch sei, nicht recht zufrieden. Nicht viel später wurden meine Eltern von meinem Fähnleinführer aufgesucht. Ich durfte bei der Unterredung nicht dabei sein. Als der Fähnleinführer gegangen war, sah ich meine Mutter in Tränen aufgelöst. Man hatte mich aus dem Jungvolk ausgeschlossen. Der Grund: der Vater meiner Mutter war jüdischer Herkunft. Nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen war ich somit „Mischling 2. Grades“, meine Mutter “Mischling 1. Grades“ . Meine Mutter klärte mich dann auf, dass ich nach den Nürnberger Gesetzen zwar kein Beamter werden könne, dass ich aber immerhin heiraten dürfe. Sie meinte dann, dass es für mich ja weniger schlimm sei, als
für sie selbst. Ich vergesse nie, wie meine Mutter mich fragte, ob ich sie jetzt noch immer liebte.
Den jüdischen Grossvater habe ich leider nicht kennengelernt. Er starb kurz nach meiner Geburt. Er war übrigens evangelisch, hatte in Nürnberg eine Spielwarenfabrik und hatte am ersten Weltkrieg als Offizier teilgenommen.

Meinen Vater stellte man vor die Alternative, entweder seine Familie zu verlassen, in welchem Falle man ihm eine große Karriere verhieß, oder er müsse eben aus der Partei und aus der SA ausgeschlossen werden. Mein Vater hat seine Familie nicht im Stich gelassen. Ab diesem Zeitpunkt kann er kein Nazi mehr gewesen sein.
Wir waren nunmehr Deutsche zweiter Klasse. Es ist mir schwer erklärlich, dass meine Eltern, so viel ich weiss, überhaupt nicht daran dachten, auszuwandern. Die überall gegenwärtige Nazipropaganda war zum großen Teil übelste Verunglimpfung der Juden. Das Hetzblatt „Der Stürmer“ des Julius Streicher war an vielen Straßenecken ausgehängt. Auf den bösen Karikaturen waren die Juden mit ganz krummen Nasen dargestellt und ich habe nachts im Bett meine Nase nach oben massiert, aus Angst, dass sie krumm werden könnte.
In der Schule hatte ich keine Schwierigkeiten. Die Lehrer haben mich nicht anders behandelt als meine Mitschüler und diese haben mich auch nicht aus ihrer Gemeinschaft ausgegrenzt. Auch Freunde der Familie und ebenso unsere Nachbarn haben sich nicht von uns abgewandt, mit einer Ausnahme. Es hat mich furchtbar getroffen, als mir eine Nachbarin, nachdem ein einziges Mal mein Ball in ihren Garten gefallen war, zurief: „Du frecher Judenlümmel!“ .
Es mag um das Jahr 1935 gewesen sein, als mein Vater erklärte, dass er versuchen wollte, meine Schwester und mich für arisch erklären zu lassen. Er kam dann mit einem Zollstock um Messungen an meinem Kopf auszuführen. Ich war ja noch ein Kind und so wurde mir weder die Lächerlichkeit der Prozedur noch die damit verbundene Demütigung bewusst. Die Ergebnisse der Messungen haben offenbar die zuständige Behörde nicht von meinem arischen Aussehen überzeugen können, denn ich musste bleiben was ich war: Mischling zweiten Grades.
Ich erinnere mich an den Morgen nach der sogenannten Reichskristallnacht; zwar habe ich von den Ausschreitungen unmittelbar nichts gesehen oder gehört. Ich weiß aber noch, dass einer unserer Lehrer vor der Klasse die Bemerkung machte, dass dies der schwärzeste Tag der deutschen Geschichte sei. In unserem Wohnzimmer hing nach wie vor ein Bild des „Führers“. Und jede Woche kam das SSBlatt „Das Schwarze Korps“ in unser Haus. Meine Eltern hatten Angst und hofften, durch angepasstes Verhalten zu überleben. Eines Tages zog eine Tante, Schwester meiner Mutter, zu uns. Sie war verlobt mit einem Zahnarzt, den sie aber nach den Nürnberger Gesetzen nicht heiraten durfte. Die Tante ist einige Zeit später nach Amerika ausgewandert unter Zurücklassung des germanischen Zahnarztes. Einige Zeit später erzählte meine Mutter, dass die Tante einen Juden geheiratet habe und zu meiner Verwunderung hat meine Mutter dies missbilligt.
Mit 14 Jahren wurde ich konfirmiert. Vorher musste ich den Konfirmandenunterricht besuchen. Der war furchtbar langweilig. Man hatte viele Strophen von Kirchenliedern auswendig zu lernen. Wir bekamen einen alten Pfarrer; der wurde mit der Bande der 14jährigen nicht so recht fertig. Plötzlich griff er mich aus der Schar heraus und verprügelte mich, ohne daß ich den Grund erfahren habe. Er wird sich gedacht haben, daß man so einem wie mir eine Tracht Prügel verabreichen kann ohne dass sich jemand beschwert. Er hatte ja Recht! Dies war übrigens das einzige Mal in meiner ganzen Schulzeit, dass ich geschlagen worden bin. Meinen Eltern habe ich von dem Vorfall nichts erzählt; die hatten so schon genug Sorgen. Der Pfarrer hieß Kopfermann und war ein übler Nazi, wie man im 4.Band von „Soest in alten Bildern“ von Dr. Gerhard Köhn nachlesen kann.
Ich hatte eine mutige Patentante. Die schimpfte auf die Nazis ohne sich darum zu kümmern, wer gerade zuhörte. Eines Tages ging ich mit ihr in einen Buchladen und ungeachtet der Leute, die da herumstanden, grüßte sie mit „Grüss Gott!“, was damals als politische Provokation gelten musste. Mir war das natürlich furchtbar peinlich; aber die Patentante erklärte, sie habe noch nie in ihrem Leben „Heil Hitler“ gesagt und dabei bleibe es.
Ich hatte Geigenunterricht. Eines Tages sollten die Schüler der Privatmusiklehrer ihr Können in einem kleinen Konzert demonstrieren. Der Leiter der Veranstaltung teilte meinem Geigenlehrer mit, dass ich aus den bekannten Gründen leider nicht teilnehmen dürfe.
Für die Schüler der unteren Klassen war am Samstag schulfrei: dafür hatten sie „HJDienst“ „Reichsjugendtag“). Ich musste als einziger der jüngeren Schüler am Samstag in die Schule gehen und wurde vom Kunsterzieher mit Bastelarbeiten beschäftigt, während im Zeichensaal nebenan eine Oberstufenklasse Kunstunterricht hatte. Obwohl ich es immer befürchtete, hat sich jedoch niemand abschätzig über meine Sonderrolle geäußert.
Meine schulischen Leistungen waren nur mittelmäßig. Auf den Zeugnissen hatte ich immer eine tadelnde Bemerkung, die meine Faulheit, nicht ohne Grund, anprangerte. Eines Tages lud mich der Schulleiter Dr. Ludwig SchulteBraucks (selbstverständlich Parteigenosse) in sein Sprechzimmer und ermahnte mich, mir doch mehr Mühe zu geben; gerade in meiner persönlichen Lage käme es doch besonders darauf an, möglichst tüchtig zu werden. Wie Recht er hatte!
Im Biologieunterricht wurde die Rassentheorie der Nazis behandelt :die nordische Rasse war die beste: blonde Haare, blaue Augen, hoher Wuchs und schmale Kopfform, das hatte ich alles nicht. Die jüdische Rasse war minderwertig. Rassenmischung mit der jüdischen galt als „ Rassenschande“ und wurde strafrechtlich verfolgt. Ich weiss nicht, ob der Lehrer all das glaubte, was er sagte; ich hatte den Eindruck, daß er diesen Unterricht widerwillig gab. Ich wusste in diesen Stunden vor lauter Peinlichkeit nicht, wohin ich meinen Blick richten sollte.
Der allgemeinen Begeisterung über den Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich haben sich meine Eltern und ich nicht entziehen können. Die Vereinnahmung des Sudetenlandes erweckte dann doch Sorgen um den Frieden und die Besetzung der RestTschechei erschien uns als Signal für den baldigen Kriegsausbruch. Ich erinnere mich deutlich, dass mir mit meinen damals 14 Jahren der Vertragsbruch und das offensichtliche Unrecht der Hitlerschen Aggression deutlich bewusst waren.
Mit 16 oder 17 Jahren genoss der gymnasiale Schülerjahrgang den obligatorischen Tanzkursus. Daran nahm auch ich teil. So manch einer der Kameraden hatte da seine Freundin und ich hätte mir auch eine gewünscht. Aber ich hatte kein Glück bei den Mädchen und ich glaubte auch zu wissen, warum.
Eines Tages warb mich ein Nachbarsjunge für den Fechtsport und so traf ich mich mit anderen Florettfechtern jede Woche in einer Turnhalle zu sportlicher Betätigung. Es handelte sich um eine Art Verein oder Club. Plötzlich wurde mir dann mitgeteilt, dass ich leider aus den leidlich bekannten Gründen nicht Mitglied dieses Vereins bleiben könne und damit fand meine Begeisterung für den Fechtsport ein abruptes Ende.
In den letzten Schuljahren hatte meine Klasse einen Lateinlehrer Dr. Kirchhoff, der als Freimaurer nicht mehr Schulleiter hat bleiben dürfen und an unsere Schule strafversetzt worden war. Jeder wusste, dass der kein Nazi war. Ich hatte davon den zweifelhaften Nutzen, dass er mir unverdient gute Noten gab.
In meinen letzten Sommerferien verdiente ich Geld: 32 Pfennige pro Stunde. Ich bekam eine Arbeit in einer Brotfabrik. Zu dem Arbeitsteam gehörte auch ein Mann mit dem Davidsstern auf dem Rock; einen solchen gelben Stern mussten damals alle Juden tragen. Die Bäcker waren trotzdem nicht unfreundiich zu dem Mann und sagten zu mir, daß das keiner von den schlimmen Juden sei. Es war nichts Auffälliges an ihm; seine Nase war auch ganz normal.
Den Kriegsausbruch erlebte ich beim Fahrradhändler. Ich musste auf eine Reparatur warten. Das Radio war eingeschaltet und ich konnte die Hitlerrede anhören, die in den Worten gipfelte: “Ab heute morgen . . . . wird zurückgeschossen.“
Die schnellen Erfolge der „eigenen“ Truppen faszinierten sogar meine Eltern und auch mich. Der schnelle Sieg über Frankreich wurde auch von uns als nationaler Triumph empfunden. Es war schwer, sich der allgemeinen Begeisterung zu entziehen. Der Überfall auf die Sowjetunion ließ dann aber doch Skepsis in Bezug auf den Endsieg und Hoffnung auf ein Kriegsende mit der Entmachtung der Nazis aufkommen.
Anfang 1942 ergaben sich für meinen Schülerjahrgang zwei Möglichkeiten: entweder wir machten im Frühjahr die Abiturprüfung und wurden dann anschließend zum Militär eingezogen oder wir meldeten uns vorher freiwillig, konnten uns dann die Truppengattung in bestimmtem Rahmen aussuchen und bekamen ohne Prüfung einen dem Abitur angeblich gleichgestellten sogenannten „Reifevermerk“ auf das Abschlusszeugnis. Ich habe mich für das letztere entschieden. Soldat hätte ich sowieso werden müssen. Die Umgehung einer Prüfung erschien mir dummerweise vorteilhaft. Und schließlich wäre ich gern zur Fliegertruppe gegangen, wozu ich als Freiwilliger glaubte, Chancen zu haben. Außerdem dachte ich mir, dass man meiner Mutter als Mutter eines deutschen Soldaten nichts anhaben hätte können. Tatsächlich haben meine Eltern den Krieg auch ohne besondere Behelligungen durch die Nazis überlebt. Ich bin allerdings doch nicht zur Luftwaffe gekommen sondern wurde Funker bei der Infanterie.
Nach kurzen Monaten der Ausbildung kam ich zum Nachrichtenzug eines „bespannten“ (d.h. mit Pferdefuhrwerken beweglichen) Infanterieregiments in den Mittelabschnitt der Ostfront. Als Soldat nahm ich keine Sonderrolle mehr ein. Hatte ich doch dieselben Embleme des NaziReiches auf dem feldgrauen Rock wie die andern. Nach meiner Abstammung hat niemand gefragt. Nur musste ich zusehen, daß man mich nicht zum Unteroffizier oder gar für die Offizierslaufbahn vorschlug, denn dann hätte ich die arische Abstammung nachweisen müssen und von da an wäre ich ja wieder gezeichnet gewesen. Also musste ich danach trachten, möglichst unauffällig zu sein. Und meinen sich immer mehr verstärkenden Wunsch, dass „wir“ den Krieg möglichst schnell verlieren sollten, musste ich verbergen mit fröhlichem Gesicht bei Siegen und mit leidvollem Ausdruck bei Niederlagen.
Ich bin dann aber doch aufgefallen, wenn auch in ganz unerwarteter Weise. Als der Regimentskommandeur Oberst Nittinger Geburtstag feiern wollte, bekam ich den Auftrag, bei Nacht mit einem Pferdefuhrwerk

zum Tross zu fahren, um dort Wein, Sekt und Spirituosen abzuholen. Mit meinen 18 Jahren habe ich mich darüber geärgert: erstens, weil ich mit einem solchen Auftrag behelligt wurde (schließlich war ich ja kein „Bursche“ , wie man die Offizersdiener nannte) und zweitens, weil es mir unmoralisch vorkam, daß Offiziere nur für diese waren die Alkoholika bestimmt eine lustige Feier veranstalteten während täglich nebenan gefallene Kameraden beerdigt wurden. Diesen meinem Ärger ließ ich freien Lauf in einem Brief an meine Eltern. Ich konnte nicht ahnen, daß die Post durch eine Zensur lief. Ich hatte das Pech. daß mein Brief geöffnet und gelesen wurde. Das hatte zur Folge, daß ich vor versammeltem Nachrichtenzug vom Regimentskommandeur erstens zu 3 Wochen “geschärften Arrest“ und als weitere Strafe in eine der Schützenkompanien versetzt wurde. Die Begründung, weiss ich noch auswendig: „. .. weil er in einem Brief an seine Eltern übertriebene Angaben über die Geburtstagsfeier eines Offiziers gemacht hat in der Absicht Unwillen in der Heimat zu erregen.“ Ich hätte die Möglichkeit gehabt “... gegen das Urteil Revision einzulegen“ mit der Folge, dass mein Fall dann vor einem Kriegsgericht verhandelt worden wäre. Dazu hatte ich freilich nicht den Mut.
Die drei Wochen geschärften Arrest verbrachte ich im Strafvollstreckungszug der Division. Es war die Weihnachtszeit des Jahres 1942. Die Kameraden, die ich jetzt hatte, waren das Bedrückendste. Es waren zumindest zum Teil Kriminelle. Irgendeine Art von Solidarität gab es nicht. Jeder war gegen jeden misstrauisch. Wir hatten von morgens früh bis spät am Abend schwere Arbeiten zu verrichten, z. Teil vor den deutschen Schützengräben. Wir hatten unsere Uniformen und Gewehre, wurden aber von den Vorgesetzten wie Untermenschen behandelt. Das Schlimmste war die psychische Situation; ich fühlte mich entehrt und war es ja auch. An Weihnachten kam der Divisionspfarrer und hielt Gottesdienst; das war trostreich.
Im Januar 43 kam ich dann zur Schützenkompanie. Der Kompanieführer empfing mich feindselig. Die Kompanie lag im Schützengraben. Es war sehr kalt. Für mich waren keine Filzstiefel mehr da. Tagsüber durfte ein Teil der Soldaten im Bunker schlafen während der andere Teil im Graben stehen mußte. In der langen Nacht dagegen mussten alle im Graben sein. Zwei Mann bildeten jeweils einen MGPosten. Einer stand am Maschinengewehr und starrte in die Dunkelheit über dem Schnee. (Man musste mit feindlichen Stoßtrupps rechnen; diese brachen nachts an einer kleinen Stelle der Front überraschend ein, nahmen Gefangene und zogen sich dann wieder zurück.) Der andere Mann durfte in einem winzigen, erbärmlichen Unterstand gleich daneben jeweils zwei Stunden schlafen. In dem Unterstand war ein kleiner Holzofen, in dem wir mit Birkenholz heizten, welches auch frisch gut brennt. Und weil wir kein Papier zum Anzünden hatten der Ofen ging ja immer wieder aus nahmen wir dazu Birkenrinde.
Auch von „unserer“ Seite wurde ein Stoßstrupp anbefohlen. Es sollten nur Freiwillige daran teilnehmen. Ich glaubte, dabei eine Chance zu haben, meine Situation zu verbessern. Das Unternehmen wurde zu einem Fiasco. Wir mussten uns im Abwehrfeuer der Russen zurückziehen, bevor wir uns dem „feindlichen“ Graben genähert hatten. Einem Kameraden hat es das Leben gekostet.
Nachts wurden auch sogenannte Spähtrupps ins Niemandsland zwischen die Fronten geschickt. Bei einem solchen Unternehmen fing ich plötzlich an laut zu sprechen. Die psychische Belastung und der Mangel an Schlaf hatten mir einen Nervenzusammenbruch eingebracht. Ich war am Ende und es wäre mir egal gewesen, wenn man mich augenblicklich erschossen hätte. So ganz genau kann ich mich an meine damalige wohl sehr dramatische Situation nicht erinnern. Jedenfalls brachte man mich in das nächste Feldlazarett, wo der Arzt mir eine Neurasthenie bescheinigte. Nachdem ich mehrere Tage und Nächte ununterbrochen geschlafen hatte, besserte sich mein Zustand.
In der Baracke, in der mein Bett neben vielen andern stand, war auch ein Einbettzimmer. Dort kurierte man den Kriegsgerichtsrat der Division. Der beorderte mich eines Tages zu sich und fragte mich nach meinem „Delikt“ aus; er musste irgendwie davon Kenntnis bekommen haben. Er war aber sehr freundlich und versprach, sich dafür einsetzen zu wollen, dass ich wieder zu meinem Nachrichtenzug zurückkehren dürfte. Ich erinnere mich, wie ich im Gespräch mit dem Kriegsgerichtsrat trotz meines noch immer etwas verwirrten Geisteszustandes permanent daran dachte, nur ja nichts von meiner nichtarischen Abstammung verlauten zu lassen. Als ich aus dem Lazarett entlassen wurde, ging ich zu meiner 5. Kompanie zurück in der Hoffnung, von da alsbald wieder zu meinem Nachrichtenzug zurückbeordert zu werden. Als ich bei der 5. Kompanie ankam, beschimpfte mich der Kompanieführer; er hielt mich für einen Simulanten. Die Truppe hatte inzwischen sehr verlustreiche Kämpfe hinter sich. Viele Kameraden waren nicht mehr da: gefallen oder verwundet. Auf die Zurückversetzung zu meiner alten Einheit wartete ich zunächst vergebens.
Im Gegensatz zu der Zeit beim Regimentsnachrichtenzug hatte ich bei der Schützenkompanie immer Hunger. Als ich einmal aus irgendeinem Grund zum Tross musste, bat ich dort um ein Brot. Der Küchensoldat sah meinen Fotoapparat und wollte diesen im Tausch gegen ein Brot haben. Ich bekam also kein Brot. Wenig später, als ich den Fotoapparat im Gepäck beim Tross gelassen hatte, ging das Gepäck durch Beschuss (angeblich) verloren.
Ich hatte in meinem Brotbeutel eine Dünndruckausgabe von Goethes Faust. Ich habe diese heute noch und man sieht, dass sie ein Loch hat. Das hat ein Granatsplitter verursacht. So hat Goethe vermutlich meinen „Heimatschuss“ verhindert.
Zu den Kameraden in der Schützenkompanie hatte ich kaum ein irgendwie persönliches Verhältnis. Für einen Analphabeten schrieb ich die Briefe an seine Frau. Dann war da Willi. Der war ganz anders. Mit dem konnte ich reden. Er strahlte etwas aus, was ihn liebenswert machte. Die Gespräche mit ihm waren mir ein rechter Trost. Den Hintergrund seiner heiteren Gelassenheit erfuhr ich dann auch. Er war sehr religiös und wollte nach dem Krieg Dominikaner werden (das wurde er dann in der Tat, trat aber schließlich wieder aus, um zu heiraten).
Im Frühsommer hatte ich meinen ersten Heimaturlaub. Als ich zurückkam, hatte unsere Division noch weit verlustreichere Kämpfe zu bestehen gehabt als im Winter. U.a. war der Regimentskommandeur gefallen, der mich verurteilt hatte. Auch Willi war nicht mehr da. Er hatte einen Heimatschuss.
Alsbald holte mich mein ehemaliger Nachrichtenzugführer zum Regimentsstab zurück. Irgendwann wurde ich zum Gefreiten „ befördert“, irgendwann zum Obergefreiten. Irgendwann wurde ich „im Namen des Führers“ mit dem Eisernen Kreuz (mit Hakenkreuz darauf) zweiter Klasse dekoriert,
irgendwann bekam ich auch das hakenkreuzverzierte Infanterie-Sturmabzeichen.

Seit Stalingrad war ich mir ganz sicher, dass der Krieg für Deutschland verloren war. Mehr und mehr konnte ich nicht verstehen, dass die militärischen Führer den aussichtslosen Kampf weiterführten. Ich fing an, die Generäle zu hassen. Die meisten meiner Kameraden haben die Russen gehasst. Die deutsche Propaganda bezeichnete sie als Untermenschen; und es hat nicht nur auf deutscher Seite sondern auch auf der gegnerischen unmenschliche Übergriffe gegeben. Ich aber sah in den russischen Soldaten genauso arme Teufel, wie wir es waren. Großes Mitleid hatte ich mit der Zivilbevölkerung, mit der wir freilich nur sehr sporadisch Kontakt hatten.
In diesem Zusammenhang sollte ich eine Szene schildern, die mich sehr beeindruckt hat. Ich war in einem kleinen Haus allein einquartiert, in dem ein älteres russisches Ehepaar wohnte. Als ich die beiden verließ, verabschiedete sich der alte Mann von mir, indem er die Arme ausbreitete und dazu offenbar etwas Religiöses sprach; es war deutlich, dass er mich segnete.
Ein Donnerbalken ist ein WC ohne Wasserspülung und ohne Brille. Es ist ein Balken statt Brille und dazu ein Erdloch. Nur der Zweck der Einrichtung ist derselbe. Und eben zu diesem Zweck saß ich 1943 auf so einem Donnerbalken. Dieser befand sich vor fremden Blicken geschützt hinter einem Bretterzaun und neben dem Holzhaus, in welchem wir Soldaten untergebracht waren. Es war dort fast friedlich; wir konnten uns sogar Hühner halten, die wir, damit sie nicht wegliefen oder nicht gestohlen wurden, unterm Fußboden einquartiert hatten. Die Idylle wurde nur hin und wieder unterbrochen durch den dumpfen Abschuss eines russischen Granatwerfers; daraufhin hörte man dann das Pfeifen der Granate und alsbald auch den Einschlag irgendwo in dem Dorf. Die Einschläge beunruhigten mich indes nicht, weil sie weit verstreut lagen man war ja allerhand Schlimmeres gewohnt. Da, plötzlich, ein Abschuss, dessen Ton mir anders schien. Mein Schutzengel oder meine Intuition meldete Alarm. Ich zog mir mitten im Geschäft die Hosen hoch und kaum hatte ich das Haus erreicht, krachte die Granate genau auf die Stelle, auf der ich soeben noch gesessen hatte. Davon habe ich dann ein Foto gemacht.

Als das Stauffenbergsche Attentat auf Hitler (20.7.1944) bekannt wurde, waren alle Kameraden erschüttert, aber es blieb verborgen, ob sie jeweils so geschockt vom Misserfolg des Attentats oder vor Abscheu gegen die Tat waren.
1944 wurde die 211. Division in Graudenz nunmehr unter dem Namen Volksgrenadierdivision neu aufgestellt, bekam neue Uniformen und musste von da an nicht wie sonst beim Militär, sondern mit gestrecktem Arm grüssen.
Von Graudenz aus kam dann der Einsatz in Ungarn.
Es war Ende 1944. Die Division lag an der Front in dem Teil der heutigen Slovakei, der auch heute noch überwiegend von Ungarn bewohnt wird. Ich sass in einem Erdloch, welches innerhalb eines zu einem Bauernhof gehörenden Areals gehörte und vermutlich der Lagerung von Kartoffeln oder anderem gedient haben mag. Ich war dabei, einen Funkspruch an den Regimentsstab durchzugeben, als mein Melder kurz zu meinem Loch hereinschaute mit der Meldung: „russische Panzer!“ . Ich morste meinen Funkspruch zu Ende und schaute aus dem Loch. Wenige Meter vor mir auf der Strasse stand ein Panzer, die Kanone in meine Richtung gedreht, mit aufgesessener Infanterie. Ich dachte: jetzt kracht`s. Es tat sich aber nichts und der Panzer fuhr dann weiter, nach ihm noch andere. Mir war klar, dass das Dorf nunmehr von Russen besetzt war. Einmal hörte ich Stimmen in der Nähe. Ich überlegte: sollte ich noch einen Funkspruch mit letzten Grüssen an meine Eltern abschicken und mich dann den Russen ergeben? Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es alsbald dunkel werden müsste. Ich entschloss mich, zu versuchen, mich Richtung Westen (einen Kompass hatte ich immer bei mir) abzusetzen und als es dunkel war, schnallte ich das 40 Pfund schwere Funkgerät über und marschierte vorsichtig los. Die weite Ebene war schwach beleuchtet durch ein in der Ferne brennendes Haus. Nach einiger Zeit grosser Angst war die Entfernung von dem Dorf so grosss geworden, dass ich mich gerettet fühlte. Ich hatte die Feldflasche voll Rotwein und in dem Gefühl meiner grossen Erleichterung trank ich die Flasche in einem Zug aus. Alsbald erreichte ich eine deutsche Stellung einer 8,8 cm FlakBatterie. Das Funkgerät bewahrte mich davor, sofort in die nächste Infanteriestellung eingereiht zu werden. Ich fand schliesslich meine Einheit wieder wobei ich es bei der Suche nicht besonders eilig hatte. Von dem zweiten Funktrupp, der beim Nachbarbataillon abgestellt gewesen war, fehlte jede Spur. Gefallen oder Gefangenschaft!
Meinen letzten Heimaturlaub bekam ich im Dezember 1944 und erlebte einen Bombenangriff auf meine Heimatstadt, die dabei zu zwei Dritteln zerstört wurde. Meinen Vater sehe ich noch mit dem Ohr nahe am „Volksempfänger“. Er hörte London. Manchmal wurde er dann richtig wütend und meinte, er würde diesen Kerl (Hitler) eigenhändig umbringen, wenn er nur eine Gelegenheit dazu hätte. Dass meine Eltern von den grauenhaften Geschehnissen in den KZs etwas wussten, glaube ich nicht. Und ich habe davon auch nichts gewusst. Und wenn ich davon ein Gerücht gehört hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Vermutlich hat man meine Eltern absichtlich von den wie ich später erfuhr ansonsten gerüchtweise wohl verbreiteten Schreckensnachrichten verschont.
Bei der Rückfahrt an die Front saß in meinem Eisenbahnabteil ein ganz junger SSSoldat. Im Gespräch machte er Andeutungen von furchtbaren Erlebnissen. Er sagte noch, dass er sich schämen müsse, zur SS zu gehören. Aber er wollte mir nicht sagen warum.
Eines Tages ich war wieder an der Front und für die Nacht war wieder „eine Frontbegradigung“, also ein Rückzug geplant, bekamen wir den Befehl, alle Häuser eines Dorfes anzuzünden, angeblich um Schussfeld frei zu machen. Da habe ich auch so ein strohgedecktes Holzhaus in Flammen aufgehen lassen. Als ich dann aber erfahren musste, dass derselbe Befehl bei jedem weiteren Rückzug ausgegeben wurde, habe ich die Unmenschlichkeit des Prinzips der verbrannten Erde erkannt und mich nicht mehr daran beteiligt, was freilich kein einziges Haus gerettet hat.

Im April 1945 war unsere Division praktisch nicht mehr existent. Sie war aufgerieben, die meisten Soldaten waren gefallen oder verwundet oder in Gefangenschaft geraten. Aber der Nachrichtenzug, zu dem ich gehörte, war noch einigermaßen funktionsfähig. Da wurden wir einer SSDivision unterstellt. Zu meinen vielen Ängsten kam noch die dazu, dass ich womöglich in Gemeinschaft mit den SSLeuten in russische Gefangenschaft geriet.
Es wurde immer deutlicher, dass der Krieg in Kürze zu Ende gehen würde. Da entschloss ich mich, mich in Richtung Westen abzusetzen. Wir waren nordwestlich von Wien. Die Amerikaner waren schon weit in Deutschland eingedrungen. Ich wollte mich bis zu ihnen durchschlagen. Eine Landkarte Österreichs hatte ich irgendwo einem Schulatlas entnommen und einen Kompass besaß ich sowieso. Eines Tages bekam ich den Befehl, ein Funkgerät zur Reparatur zu bringen. So kam ich zu einem Marschbefehl, mit dem ich ganz legal ein gutes Stück hinter die Front gelangen konnte. Ich bekam ein Fahrrad, hatte eine Maschinenpistole und eine Pistole. Das Funkgerät habe ich ordnungsgemäß abgeliefert. Dann bin ich zu einem Bauernhof gefahren, wo wir einige Zeit vorher einquartiert gewesen waren und wo ich mich in die Tochter verliebt hatte. Die guten Leute gaben mir einen Lebensmittelvorrat mit auf den Weg. Ihren Wunsch, die Tochter mit in den Westen zu nehmen, habe ich den verängstigten Eitern (es waren deutsche Bauern, die vor ihren tschechischen Landsleuten sehr berechtigte Angst hatten) vernünftigerweise ausschlagen müssen.
Noch war ich nicht vom legalen Weg abgekommen. Aber dann stand ich vor der militärisch bewachten Brücke über die Thaia. Ich bin unbehelligt hinüber gefahren und damit war ich endgültig auf der anderen Seite: vogelfreier Deserteur, zum Tode verurteilt! Aber ich war frei und hatte die Hoffnung, bald wieder zu Hause bei meinen Eltern zu sein. Das Fahrrad und die Maschinenpistole habe ich alsbald irgendwo liegen gelassen. Ich marschierte nur nachts. Ich orientierte mich mit Hilfe der Landkarte und des Kompasses.
Nachdem ich ein paar Nächte nur querfeldein, vorzugsweise durch Wälder, gewandert war und alles so glatt lief wurde ich leichtsinnig und ging auf einer Straße, erreichte ein Dorf in der irrigen Meinung, dass nachts um 3 Uhr alles schlafen würde. Plötzlich stand vor mir ein sogenannter Kettenhund, also ein Feldgendarm. Der fragte mich nach einem Marschbefehl und legte alsbald seine Hand auf meine Schulter und verkündete mir: “Sie sind verhaftet!“ Ich versuchte sofort, zu fliehen. Als der Mann mich festhalten wollte, hatte ich schon meine Pistole entsichert; er war wohl ebenso überrascht wie ich; jedenfalls gelang es mir, mich seinem Zugriff zu entreissen ohne dass ich schießen mußte, was ich aber ohne Zögern getan hätte, wenn ich denn nicht anders hätte frei kommen können. Ich lief so schnell ich konnte aus dem Dorf hinaus, während der Feldgendarm lauthals die Wache alarmierte. Als ich aus dem Dorf heraus war, ganz außer Atem, versteckte ich mich abseits in einem Gebüsch. Die Wache fuhr alsbald auf der Straße zum Dorf hinaus mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Als das Auto dann zurückgekehrt war, entkam ich endgültig. Freilich hatte ich bei dem Handgemenge die Tasche mit meinen Lebensmitteln verloren, ebenso meine Kopfbedeckung. Ich besaß aber zum Glück noch die Landkarte und den Kompass.
So kam ich ein Stück weiter im niederösterreichischen Gebirge südlich Gmünd. Dabei hatte ich zunächst immer Angst, doch noch verfolgt zu werden. Schließlich gönnte ich mir ein paar Stunden Halbschlaf auf einem JägerHochstand. Es fing an zu schneien, ich fror und der Hunger meldete sich mit aller Macht; hatte ich doch in all den Tagen meiner Flucht nur ganz wenig gegessen, weil ich ja nicht wußte, für wie lange meine Vorräte reichen mussten. Es war klar: Lebensmittel konnte ich nur von Menschen erhalten; und diese mußte ich doch am meisten fürchten. Es blieb mir aber keine andere Wahl, als an irgendeine einsame Haustür zu klopfen. Die Leute gaben mir aber nichts; sie durchschauten meine Lage und hatten Angst.
Ich war nahezu verzweifelt. Als ich mich einem kleinen Dorf näherte, sah ich, dass sich Soldaten dort aufhielten. Mir fiel auf, daß sie nicht die Uniform der Wehrmacht trugen. Ich schlich mich heran, bis ich verstehen konnte, in welcher Sprache sie redeten. Das war zu meiner Überraschung deutsch und schließlich begriff ich, daß es sich um Deutschungarn handelte. lch überlegte einen Moment, daß diese Menschen mit dem Krieg und den Nazis nichts mehr im Sinn haben konnten und fasste daher den Mut, zu ihnen zu gehen und ihnen offen meine Situation zu schildern. Ich bekam sofort etwas zu essen und weil ich gar so abgerissen aussah, meinten die guten Menschen, ich müsse unbedingt wenigstens eine Nacht bei ihnen ruhen. Ich fasste Vertrauen und schlief dann gut bei ihnen in der Scheune, die Pistole unter meinem Kopf.
Als ich am andern Morgen weiterziehen wollte, meinten meine Gastgeber, daß ich das vorerst lieber lassen sollte, weil nämlich SSEinheiten die Wälder der Umgebung durchkämmten und alle Deserteure am nächsten Baum aufknüpfen würden. So blieb ich also und damit ich mich nicht verstecken mußte, gaben sie mir eine ungarische Uniform. So konnte ich mich frei bewegen und war relativ sicher.
In einer der nächsten Nächte gab es plötzlich großen Lärm; es war Alarm. Den Ungarn war befohlen worden, mit ihren Kanonen nach Norden in die Tschechei zu stoßen; dort sei ein Aufstand ausgebrochen; den gelte es niederzuwerfen. Ich solle mit ihnen kommen oder beiben.
Ich blieb und schlief bis zum andern Morgen. Als ich aufwachte, lag neben mir Zivilkleidung. Ich habe nie erfahren, wer mir die dahin gelegt hat, die Ungarn oder etwa der Bauer, auf dessen Hof die Scheune lag. Dieser Bauer, der sich die ganze Zeit über nicht hatte blicken lassen, kam an diesem Morgen zu mir und verkündete, es sei Waffenstillstand. Es war der 8. Mai 1945. Der Tag der Befreiung!!!
Die Amerikaner waren auf Linz vorgestoßen. Bis dahin waren es nur einige zehn Kilometer. Bevor ich mich auf den Weg machte, lud mich der Bauer zum Mittagessen ein. Es gab Sauerbraten und Knödel. Danach marschierte ich los. In Prägarten bei Linz passierte ich bewaffnete ehemalige französische Gefangene, dann auch amerikanische Posten. Der weitere Heimweg war im Vergleich zur Dramatik des ersten Teils fast eine Vergnügungsreise, auch wenn diese durch eine dreitägige amerikanische Gefangenschaft in Ochsenfurt unliebsam unterbrochen wurde. Ein Stück des Weges ging ich gemeinsam mit einem Mann, der erzählte, Gefangener des KZ's Mauthausen gewesen zu sein; er stammte aus dem Ruhrgebiet und war dort als Kommunist verhaftet worden. Ich weiß nicht mehr, was er mir aus seiner KZZeit erzählt hat; das volle Ausmaß der schrecklichen Unmenschlichkeiten, die in den Lagern passiert sind, habe ich jedenfalls erst später erfahren. Ich war Zeuge, wie ein Mann in deutscher Uniform von amerikanischen Soldaten das Steilufer der Donau hinunter geworfen wurde; er rührte sich nicht mehr. Als ich einen der amerikanischen Soldaten daraufhin ansprach ich war entsetzt, weil ich den Amerikanern so etwas nicht zugetraut hatte , erhielt ich nur zur Antwort, dass der Mann bei der SS gewesen sei.
Anfang Juni kam ich zu meinen Eltern zurück. Ich war glücklich, endlich frei und außer Gefahr zu sein. Die Besatzungssoldaten sah ich als Befreier an. Allerdings ärgerte es mich, daß die Engländer in meiner Heimatstadt die Passanten verpflichteten die Fahne Grossbritanniens durch Hut abnehmen zu grüßen. Zwar konnte man sich dem entziehen, indem man den Hut schon lange vor dem Passieren unter den Arm klemmte. Es war sinnlose Schikane. In der Sylvesternacht 45/46 habe ich zusammen mit einem Freund eines der die Demütigung anordnenden Gebotsschilder geraubt, mit nach Hause genommen und in der Heizung verbrannt. Gott sei Dank sind den Engländern die Urheber des Delikts nicht bekannt geworden.
Einige Zeit später versicherte mir ein ehemaliger Offizier, der es wissen musste, dass man mich und meinesgleichen, hätten denn die Nazis den Krieg gewonnen, im Rahmen der „Endlösung“ auch noch umgebracht hätte.
**************
1924 in der kleinen Stadt Soest/Westf. geboren, war ich 1933 neun Jahre alt; das Ende der Hitlerdiktatur erlebte ich als 21Jähriger. Meine ersten Lebensjahre fielen in die Zeit nach dem ersten Weltkrieg. Inflation, die Besetzung des Rheinlandes durch französisches Militär, Weltwirtschaftskrise, Arbeitslosigkeit: die Weimarer Demokratie hatte es schwer, unter so negativen Umständen im Volk Wurzeln zu schlagen. Die triumphale Politik der Siegermächte heizte den Nationalismus in den Köpfen der meisten Deutschen immer mehr an.
Mein Vater hatte als einfacher Soldat am Krieg teilgenommen und war in einem Unterstand an der Westfront verschüttet worden. Die Situation im Schützengraben hat er in einem Modell nachgebaut, so dass ich meine Spielzeugsoldaten in eine perfekte Kulisse stellen konnte. Eine Heizvorrichtung ermöglichte es, mit Hilfe von sogenannten Knalldöppchen Gewehrschüsse einschliesslich Pulvergeruch zu imitieren.
Neben den feldgrauen Soldaten hatte ich bei meinem Spielzeug auch andere: SA und SS-Männer. Einer trug eine flatternde Hakenkreuzfahne und Hitler persönlich war auch dabei. Den Hitlerarm konnte man zum Gruß nach oben biegen. So ließ ich dann die braunen Kolonnen am Führer vorbeimarschieren.
Mein Vater hatte eine schöne braune Uniform, bei der mir das Koppel und der Schulterriemen mit Karabinerhaken besonders imponierten und das Parteiabzeichen hatte er schon vor 1933. Er war „alter Kämpfer“, wie man damals sagte. Mein Vater war ein sehr gütiger Mensch. Er konnte, wie man so sagt, keiner Fliege etwas zuleide tun. Aber er glaubte damals wie so viele, dass die braune Bewegung gut für Deutschland sei. Dafür im nachhinein Verständnis zu haben fällt mir schwer. Eher begreiflich ist mir auch heute noch die antikommunistische Einstellung meines Vaters. Er hatte an den Kämpfen gegen die Roten im Freikorps „Oberland“ in München teilgenommen.
Im Jahr 1930 kam ich in die evangelische Volksschule. Ich erinnere mich, dass so viele Mitschüler auf die wohl öfter gestellte Frage nach dem Beruf des Vaters „ arbeitslos“ antworteten. Ich erinnere mich an den Lehrer; der Rohrstock war sein regelmässig gebrauchtes Erziehungswerkszeug. Das Gebrüll, welches auf die Züchtigungen folgte (die Knaben bekamen's auf den Hosenboden, die Mädchen auf die Hand), war schrecklich. Ich selbst bin aber von solcher Tortur verschont geblieben, wohl weil ich dem Lehrer keinen Anlass dazu gegeben habe. Auch habe ich den Lehrer als durchaus gütigen Menschen in Erinnerung. Die mit dem Rohrstock erzwungene Ordnung ließ uns bei ihm eine Menge lernen: z. B. meine Kenntnisse in „ Heimatkunde“ stammen noch aus heutiger Erinnerung von ihm.
In der Turnstunde war gelegentlich „Stangenklettern“ dran. Dabei spielten Würste eine bedeutende Rolle. Bevor so eine Riege von Kindern die Stangen hinaufkletterte hatte der Lehrer über Seile die mitgebrachten (und von ihm auch wohl bezahlten), Würste so befestigt, dass er sie den Klettermaxen beim Klettern vor die Nase hielt und manchmal gelang es einem kleinen Turner, eine Wurst zu ergattern. Mir ist es nie gelungen; ich habe aber bald bemerkt, dass die mittels der Schnur geregelte Wurstzuteilung nicht nach sportlichen, sondern nach sozialen Gesichtspunkten erfolgte.
Ich erinnere mich noch heute an den 30. Januar 1933. Meine Eltern haben sich gefreut. Von jetzt an würde es ja aufwärts gehen. Am Abend waren wir zu Gast bei Bekannten, von deren Fenstern aus wir den Fackelzug der SA beobachteten. Es war eine fröhliche Stimmung. “ Wir“ hatten gewonnen, so kam es auch mir vor.
Die Hitlerjugend gab es schon. Für die zehn bis 14jährigen Jungen wurde das „Jungvolk“ gegründet. „Pimpfe“ hießen die Mitglieder. Selbstverständlich waren sie auch uniformiert: Braunhemd, schwarzes Halstuch, ganz kurze Cordhose, Koppelschloß, Schulterriemen mit Karabinerhaken, Fahrtenmesser (darauf stand „Blut und Ehre“, wenn ich mich richtig erinnere), eine schiffchenförmige Kopfbedeckung und für die kalte Jahreszeit eine dunkelblaue, kurze Jacke mit silberschimmernden Knöpfen. Da wollte ich dabei sein; allein schon wegen der Uniform! Und obwohl ich für die Aufnahme in das Jungvolk noch ein Jahr zu jung war, wurde ich akzeptiert.
Das Jungvolk, wie auch die Hitlerjugend, war militärisch organisiert. Der Kompanie entsprach das Fähnlein, dem der Fähnleinführer vorstand. Die als „Dienst“ bezeichneten Zusammenkünfte bestanden aus Exerzieren, „weltanschaulicher Schulung“ und

Körperertüchtigung. Auch Zeltlager standen auf dem Programm, mit Lagerfeuer, nächtlichem Wacheschieben und kriegerischen Spielen.
1934 kam ich auf die Oberrealschule. Von meiner Volksschulklasse wechselten nur drei Schüler auf eine weiterführende Schule. Von diesen war ich dann der einzige, der bis zum Abitur kam.
Irgendwann nahm ich den überall propagierten Antisemitismus wahr. Er war mir unverständlich. Ich habe meinen Vater danach befragt und der meinte, dass zu viele Juden in Schlüsselpositionen säßen und es gelte, deren Einfluss zurückzudrängen. Im übrigen glaubte er, dass nichts so heiß gegessen wie gekocht würde. Wie er sich darin irrte, wurde alsbald offenbar.
In der Schule hatte ich einen jüdischen Schulkameraden; er hiess G. Lilienfeldt und hatte rote Haare. Eines Nachmittags traf ich ihn auf dem Marktplatz und sprach mit ihm. Da kam ein etwas älterer Hitlerjunge vorbei und schimpfte mit mir, dass ich, und dazu noch in Uniform, mit einem Juden spräche. Ich ließ mich einschüchtern, wandte mich von meinem Gesprächspartner ab und schämte mich zugleich meiner Feigheit; wohl aus diesem Grund erinnere ich mich noch so genau an die Szene. Der jüdische Mitschüler hat noch im Jahr 1934 die Schule verlassen müssen. Vor einigen Jahren erfuhr ich, daß er das „ tausendjährige Reich“ überlebt hat. Ich schrieb ihm und er antwortete sehr freundlich.
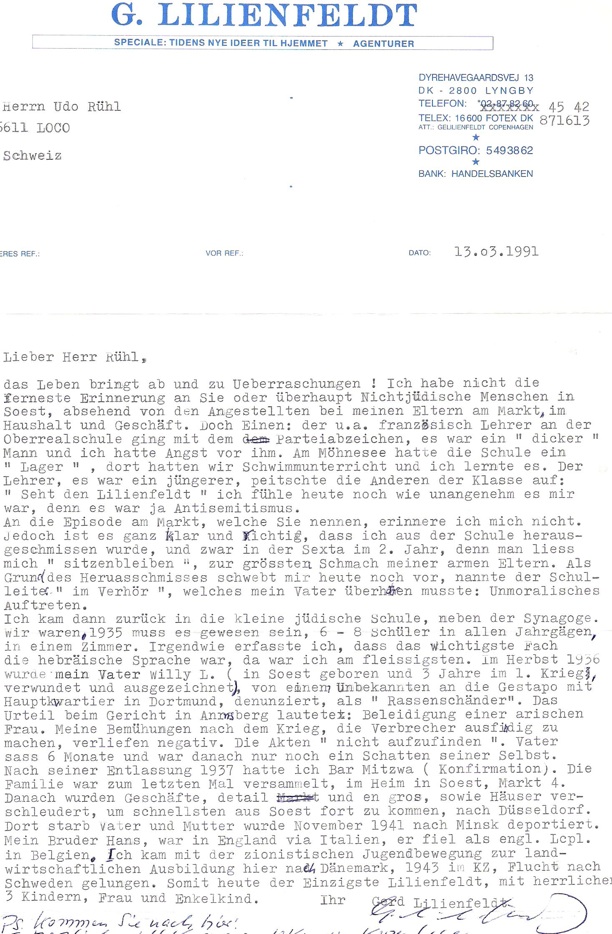
In den Parkanlagen der Stadt wurden Schilder aufgestellt, nach denen Juden der Aufenthalt dort verboten war. Eines Tages sprachen mich ein paar ausländische jugendliche Touristen an ich glaube, es waren Engländer und fragten, warum denn Juden den Park nicht aufsuchen durften. Ich wußte nicht, was ich antworten sollte. Es war mir peinlich. Dies ist wohl der Grund dafür, daß mir die Szene so deutlich in Erinnerung geblieben ist.
Ich glaube, es war im Sommer 1934, als meine Eltern mit meiner Schwester und mir zwei Wochen Ferien in Berchtesgaden machten. Eines Tages hieß es: der Führer kommt auf den Obersalzberg. Eine große Menschenmenge bewegte sich auf der Straße an dem Reichskanzler vorbei und die Kinder durften vorkommen und Hitler die Hand drücken. Auch meine Schwester und ich haben dem Führer die Hand gegeben.
Eines Tages fragte mich ein älterer Hitlerjunge, was für eine Konfession meine Großmutter habe und er schien mit meiner Antwort auf die mir ganz unverständliche Frage, dass sie, wie die übrige Familie, evangelisch sei, nicht recht zufrieden. Nicht viel später wurden meine Eltern von meinem Fähnleinführer aufgesucht. Ich durfte bei der Unterredung nicht dabei sein. Als der Fähnleinführer gegangen war, sah ich meine Mutter in Tränen aufgelöst. Man hatte mich aus dem Jungvolk ausgeschlossen. Der Grund: der Vater meiner Mutter war jüdischer Herkunft. Nach den sogenannten Nürnberger Gesetzen war ich somit „Mischling 2. Grades“, meine Mutter “Mischling 1. Grades“ . Meine Mutter klärte mich dann auf, dass ich nach den Nürnberger Gesetzen zwar kein Beamter werden könne, dass ich aber immerhin heiraten dürfe. Sie meinte dann, dass es für mich ja weniger schlimm sei, als
für sie selbst. Ich vergesse nie, wie meine Mutter mich fragte, ob ich sie jetzt noch immer liebte.
Den jüdischen Grossvater habe ich leider nicht kennengelernt. Er starb kurz nach meiner Geburt. Er war übrigens evangelisch, hatte in Nürnberg eine Spielwarenfabrik und hatte am ersten Weltkrieg als Offizier teilgenommen.

Meinen Vater stellte man vor die Alternative, entweder seine Familie zu verlassen, in welchem Falle man ihm eine große Karriere verhieß, oder er müsse eben aus der Partei und aus der SA ausgeschlossen werden. Mein Vater hat seine Familie nicht im Stich gelassen. Ab diesem Zeitpunkt kann er kein Nazi mehr gewesen sein.
Wir waren nunmehr Deutsche zweiter Klasse. Es ist mir schwer erklärlich, dass meine Eltern, so viel ich weiss, überhaupt nicht daran dachten, auszuwandern. Die überall gegenwärtige Nazipropaganda war zum großen Teil übelste Verunglimpfung der Juden. Das Hetzblatt „Der Stürmer“ des Julius Streicher war an vielen Straßenecken ausgehängt. Auf den bösen Karikaturen waren die Juden mit ganz krummen Nasen dargestellt und ich habe nachts im Bett meine Nase nach oben massiert, aus Angst, dass sie krumm werden könnte.
In der Schule hatte ich keine Schwierigkeiten. Die Lehrer haben mich nicht anders behandelt als meine Mitschüler und diese haben mich auch nicht aus ihrer Gemeinschaft ausgegrenzt. Auch Freunde der Familie und ebenso unsere Nachbarn haben sich nicht von uns abgewandt, mit einer Ausnahme. Es hat mich furchtbar getroffen, als mir eine Nachbarin, nachdem ein einziges Mal mein Ball in ihren Garten gefallen war, zurief: „Du frecher Judenlümmel!“ .
Es mag um das Jahr 1935 gewesen sein, als mein Vater erklärte, dass er versuchen wollte, meine Schwester und mich für arisch erklären zu lassen. Er kam dann mit einem Zollstock um Messungen an meinem Kopf auszuführen. Ich war ja noch ein Kind und so wurde mir weder die Lächerlichkeit der Prozedur noch die damit verbundene Demütigung bewusst. Die Ergebnisse der Messungen haben offenbar die zuständige Behörde nicht von meinem arischen Aussehen überzeugen können, denn ich musste bleiben was ich war: Mischling zweiten Grades.
Ich erinnere mich an den Morgen nach der sogenannten Reichskristallnacht; zwar habe ich von den Ausschreitungen unmittelbar nichts gesehen oder gehört. Ich weiß aber noch, dass einer unserer Lehrer vor der Klasse die Bemerkung machte, dass dies der schwärzeste Tag der deutschen Geschichte sei. In unserem Wohnzimmer hing nach wie vor ein Bild des „Führers“. Und jede Woche kam das SSBlatt „Das Schwarze Korps“ in unser Haus. Meine Eltern hatten Angst und hofften, durch angepasstes Verhalten zu überleben. Eines Tages zog eine Tante, Schwester meiner Mutter, zu uns. Sie war verlobt mit einem Zahnarzt, den sie aber nach den Nürnberger Gesetzen nicht heiraten durfte. Die Tante ist einige Zeit später nach Amerika ausgewandert unter Zurücklassung des germanischen Zahnarztes. Einige Zeit später erzählte meine Mutter, dass die Tante einen Juden geheiratet habe und zu meiner Verwunderung hat meine Mutter dies missbilligt.
Mit 14 Jahren wurde ich konfirmiert. Vorher musste ich den Konfirmandenunterricht besuchen. Der war furchtbar langweilig. Man hatte viele Strophen von Kirchenliedern auswendig zu lernen. Wir bekamen einen alten Pfarrer; der wurde mit der Bande der 14jährigen nicht so recht fertig. Plötzlich griff er mich aus der Schar heraus und verprügelte mich, ohne daß ich den Grund erfahren habe. Er wird sich gedacht haben, daß man so einem wie mir eine Tracht Prügel verabreichen kann ohne dass sich jemand beschwert. Er hatte ja Recht! Dies war übrigens das einzige Mal in meiner ganzen Schulzeit, dass ich geschlagen worden bin. Meinen Eltern habe ich von dem Vorfall nichts erzählt; die hatten so schon genug Sorgen. Der Pfarrer hieß Kopfermann und war ein übler Nazi, wie man im 4.Band von „Soest in alten Bildern“ von Dr. Gerhard Köhn nachlesen kann.
Ich hatte eine mutige Patentante. Die schimpfte auf die Nazis ohne sich darum zu kümmern, wer gerade zuhörte. Eines Tages ging ich mit ihr in einen Buchladen und ungeachtet der Leute, die da herumstanden, grüßte sie mit „Grüss Gott!“, was damals als politische Provokation gelten musste. Mir war das natürlich furchtbar peinlich; aber die Patentante erklärte, sie habe noch nie in ihrem Leben „Heil Hitler“ gesagt und dabei bleibe es.
Ich hatte Geigenunterricht. Eines Tages sollten die Schüler der Privatmusiklehrer ihr Können in einem kleinen Konzert demonstrieren. Der Leiter der Veranstaltung teilte meinem Geigenlehrer mit, dass ich aus den bekannten Gründen leider nicht teilnehmen dürfe.
Für die Schüler der unteren Klassen war am Samstag schulfrei: dafür hatten sie „HJDienst“ „Reichsjugendtag“). Ich musste als einziger der jüngeren Schüler am Samstag in die Schule gehen und wurde vom Kunsterzieher mit Bastelarbeiten beschäftigt, während im Zeichensaal nebenan eine Oberstufenklasse Kunstunterricht hatte. Obwohl ich es immer befürchtete, hat sich jedoch niemand abschätzig über meine Sonderrolle geäußert.
Meine schulischen Leistungen waren nur mittelmäßig. Auf den Zeugnissen hatte ich immer eine tadelnde Bemerkung, die meine Faulheit, nicht ohne Grund, anprangerte. Eines Tages lud mich der Schulleiter Dr. Ludwig SchulteBraucks (selbstverständlich Parteigenosse) in sein Sprechzimmer und ermahnte mich, mir doch mehr Mühe zu geben; gerade in meiner persönlichen Lage käme es doch besonders darauf an, möglichst tüchtig zu werden. Wie Recht er hatte!
Im Biologieunterricht wurde die Rassentheorie der Nazis behandelt :die nordische Rasse war die beste: blonde Haare, blaue Augen, hoher Wuchs und schmale Kopfform, das hatte ich alles nicht. Die jüdische Rasse war minderwertig. Rassenmischung mit der jüdischen galt als „ Rassenschande“ und wurde strafrechtlich verfolgt. Ich weiss nicht, ob der Lehrer all das glaubte, was er sagte; ich hatte den Eindruck, daß er diesen Unterricht widerwillig gab. Ich wusste in diesen Stunden vor lauter Peinlichkeit nicht, wohin ich meinen Blick richten sollte.
Der allgemeinen Begeisterung über den Anschluß Österreichs an das Deutsche Reich haben sich meine Eltern und ich nicht entziehen können. Die Vereinnahmung des Sudetenlandes erweckte dann doch Sorgen um den Frieden und die Besetzung der RestTschechei erschien uns als Signal für den baldigen Kriegsausbruch. Ich erinnere mich deutlich, dass mir mit meinen damals 14 Jahren der Vertragsbruch und das offensichtliche Unrecht der Hitlerschen Aggression deutlich bewusst waren.
Mit 16 oder 17 Jahren genoss der gymnasiale Schülerjahrgang den obligatorischen Tanzkursus. Daran nahm auch ich teil. So manch einer der Kameraden hatte da seine Freundin und ich hätte mir auch eine gewünscht. Aber ich hatte kein Glück bei den Mädchen und ich glaubte auch zu wissen, warum.
Eines Tages warb mich ein Nachbarsjunge für den Fechtsport und so traf ich mich mit anderen Florettfechtern jede Woche in einer Turnhalle zu sportlicher Betätigung. Es handelte sich um eine Art Verein oder Club. Plötzlich wurde mir dann mitgeteilt, dass ich leider aus den leidlich bekannten Gründen nicht Mitglied dieses Vereins bleiben könne und damit fand meine Begeisterung für den Fechtsport ein abruptes Ende.
In den letzten Schuljahren hatte meine Klasse einen Lateinlehrer Dr. Kirchhoff, der als Freimaurer nicht mehr Schulleiter hat bleiben dürfen und an unsere Schule strafversetzt worden war. Jeder wusste, dass der kein Nazi war. Ich hatte davon den zweifelhaften Nutzen, dass er mir unverdient gute Noten gab.
In meinen letzten Sommerferien verdiente ich Geld: 32 Pfennige pro Stunde. Ich bekam eine Arbeit in einer Brotfabrik. Zu dem Arbeitsteam gehörte auch ein Mann mit dem Davidsstern auf dem Rock; einen solchen gelben Stern mussten damals alle Juden tragen. Die Bäcker waren trotzdem nicht unfreundiich zu dem Mann und sagten zu mir, daß das keiner von den schlimmen Juden sei. Es war nichts Auffälliges an ihm; seine Nase war auch ganz normal.
Den Kriegsausbruch erlebte ich beim Fahrradhändler. Ich musste auf eine Reparatur warten. Das Radio war eingeschaltet und ich konnte die Hitlerrede anhören, die in den Worten gipfelte: “Ab heute morgen . . . . wird zurückgeschossen.“
Die schnellen Erfolge der „eigenen“ Truppen faszinierten sogar meine Eltern und auch mich. Der schnelle Sieg über Frankreich wurde auch von uns als nationaler Triumph empfunden. Es war schwer, sich der allgemeinen Begeisterung zu entziehen. Der Überfall auf die Sowjetunion ließ dann aber doch Skepsis in Bezug auf den Endsieg und Hoffnung auf ein Kriegsende mit der Entmachtung der Nazis aufkommen.
Anfang 1942 ergaben sich für meinen Schülerjahrgang zwei Möglichkeiten: entweder wir machten im Frühjahr die Abiturprüfung und wurden dann anschließend zum Militär eingezogen oder wir meldeten uns vorher freiwillig, konnten uns dann die Truppengattung in bestimmtem Rahmen aussuchen und bekamen ohne Prüfung einen dem Abitur angeblich gleichgestellten sogenannten „Reifevermerk“ auf das Abschlusszeugnis. Ich habe mich für das letztere entschieden. Soldat hätte ich sowieso werden müssen. Die Umgehung einer Prüfung erschien mir dummerweise vorteilhaft. Und schließlich wäre ich gern zur Fliegertruppe gegangen, wozu ich als Freiwilliger glaubte, Chancen zu haben. Außerdem dachte ich mir, dass man meiner Mutter als Mutter eines deutschen Soldaten nichts anhaben hätte können. Tatsächlich haben meine Eltern den Krieg auch ohne besondere Behelligungen durch die Nazis überlebt. Ich bin allerdings doch nicht zur Luftwaffe gekommen sondern wurde Funker bei der Infanterie.
Nach kurzen Monaten der Ausbildung kam ich zum Nachrichtenzug eines „bespannten“ (d.h. mit Pferdefuhrwerken beweglichen) Infanterieregiments in den Mittelabschnitt der Ostfront. Als Soldat nahm ich keine Sonderrolle mehr ein. Hatte ich doch dieselben Embleme des NaziReiches auf dem feldgrauen Rock wie die andern. Nach meiner Abstammung hat niemand gefragt. Nur musste ich zusehen, daß man mich nicht zum Unteroffizier oder gar für die Offizierslaufbahn vorschlug, denn dann hätte ich die arische Abstammung nachweisen müssen und von da an wäre ich ja wieder gezeichnet gewesen. Also musste ich danach trachten, möglichst unauffällig zu sein. Und meinen sich immer mehr verstärkenden Wunsch, dass „wir“ den Krieg möglichst schnell verlieren sollten, musste ich verbergen mit fröhlichem Gesicht bei Siegen und mit leidvollem Ausdruck bei Niederlagen.
Ich bin dann aber doch aufgefallen, wenn auch in ganz unerwarteter Weise. Als der Regimentskommandeur Oberst Nittinger Geburtstag feiern wollte, bekam ich den Auftrag, bei Nacht mit einem Pferdefuhrwerk

zum Tross zu fahren, um dort Wein, Sekt und Spirituosen abzuholen. Mit meinen 18 Jahren habe ich mich darüber geärgert: erstens, weil ich mit einem solchen Auftrag behelligt wurde (schließlich war ich ja kein „Bursche“ , wie man die Offizersdiener nannte) und zweitens, weil es mir unmoralisch vorkam, daß Offiziere nur für diese waren die Alkoholika bestimmt eine lustige Feier veranstalteten während täglich nebenan gefallene Kameraden beerdigt wurden. Diesen meinem Ärger ließ ich freien Lauf in einem Brief an meine Eltern. Ich konnte nicht ahnen, daß die Post durch eine Zensur lief. Ich hatte das Pech. daß mein Brief geöffnet und gelesen wurde. Das hatte zur Folge, daß ich vor versammeltem Nachrichtenzug vom Regimentskommandeur erstens zu 3 Wochen “geschärften Arrest“ und als weitere Strafe in eine der Schützenkompanien versetzt wurde. Die Begründung, weiss ich noch auswendig: „. .. weil er in einem Brief an seine Eltern übertriebene Angaben über die Geburtstagsfeier eines Offiziers gemacht hat in der Absicht Unwillen in der Heimat zu erregen.“ Ich hätte die Möglichkeit gehabt “... gegen das Urteil Revision einzulegen“ mit der Folge, dass mein Fall dann vor einem Kriegsgericht verhandelt worden wäre. Dazu hatte ich freilich nicht den Mut.
Die drei Wochen geschärften Arrest verbrachte ich im Strafvollstreckungszug der Division. Es war die Weihnachtszeit des Jahres 1942. Die Kameraden, die ich jetzt hatte, waren das Bedrückendste. Es waren zumindest zum Teil Kriminelle. Irgendeine Art von Solidarität gab es nicht. Jeder war gegen jeden misstrauisch. Wir hatten von morgens früh bis spät am Abend schwere Arbeiten zu verrichten, z. Teil vor den deutschen Schützengräben. Wir hatten unsere Uniformen und Gewehre, wurden aber von den Vorgesetzten wie Untermenschen behandelt. Das Schlimmste war die psychische Situation; ich fühlte mich entehrt und war es ja auch. An Weihnachten kam der Divisionspfarrer und hielt Gottesdienst; das war trostreich.
Im Januar 43 kam ich dann zur Schützenkompanie. Der Kompanieführer empfing mich feindselig. Die Kompanie lag im Schützengraben. Es war sehr kalt. Für mich waren keine Filzstiefel mehr da. Tagsüber durfte ein Teil der Soldaten im Bunker schlafen während der andere Teil im Graben stehen mußte. In der langen Nacht dagegen mussten alle im Graben sein. Zwei Mann bildeten jeweils einen MGPosten. Einer stand am Maschinengewehr und starrte in die Dunkelheit über dem Schnee. (Man musste mit feindlichen Stoßtrupps rechnen; diese brachen nachts an einer kleinen Stelle der Front überraschend ein, nahmen Gefangene und zogen sich dann wieder zurück.) Der andere Mann durfte in einem winzigen, erbärmlichen Unterstand gleich daneben jeweils zwei Stunden schlafen. In dem Unterstand war ein kleiner Holzofen, in dem wir mit Birkenholz heizten, welches auch frisch gut brennt. Und weil wir kein Papier zum Anzünden hatten der Ofen ging ja immer wieder aus nahmen wir dazu Birkenrinde.
Auch von „unserer“ Seite wurde ein Stoßstrupp anbefohlen. Es sollten nur Freiwillige daran teilnehmen. Ich glaubte, dabei eine Chance zu haben, meine Situation zu verbessern. Das Unternehmen wurde zu einem Fiasco. Wir mussten uns im Abwehrfeuer der Russen zurückziehen, bevor wir uns dem „feindlichen“ Graben genähert hatten. Einem Kameraden hat es das Leben gekostet.
Nachts wurden auch sogenannte Spähtrupps ins Niemandsland zwischen die Fronten geschickt. Bei einem solchen Unternehmen fing ich plötzlich an laut zu sprechen. Die psychische Belastung und der Mangel an Schlaf hatten mir einen Nervenzusammenbruch eingebracht. Ich war am Ende und es wäre mir egal gewesen, wenn man mich augenblicklich erschossen hätte. So ganz genau kann ich mich an meine damalige wohl sehr dramatische Situation nicht erinnern. Jedenfalls brachte man mich in das nächste Feldlazarett, wo der Arzt mir eine Neurasthenie bescheinigte. Nachdem ich mehrere Tage und Nächte ununterbrochen geschlafen hatte, besserte sich mein Zustand.
In der Baracke, in der mein Bett neben vielen andern stand, war auch ein Einbettzimmer. Dort kurierte man den Kriegsgerichtsrat der Division. Der beorderte mich eines Tages zu sich und fragte mich nach meinem „Delikt“ aus; er musste irgendwie davon Kenntnis bekommen haben. Er war aber sehr freundlich und versprach, sich dafür einsetzen zu wollen, dass ich wieder zu meinem Nachrichtenzug zurückkehren dürfte. Ich erinnere mich, wie ich im Gespräch mit dem Kriegsgerichtsrat trotz meines noch immer etwas verwirrten Geisteszustandes permanent daran dachte, nur ja nichts von meiner nichtarischen Abstammung verlauten zu lassen. Als ich aus dem Lazarett entlassen wurde, ging ich zu meiner 5. Kompanie zurück in der Hoffnung, von da alsbald wieder zu meinem Nachrichtenzug zurückbeordert zu werden. Als ich bei der 5. Kompanie ankam, beschimpfte mich der Kompanieführer; er hielt mich für einen Simulanten. Die Truppe hatte inzwischen sehr verlustreiche Kämpfe hinter sich. Viele Kameraden waren nicht mehr da: gefallen oder verwundet. Auf die Zurückversetzung zu meiner alten Einheit wartete ich zunächst vergebens.
Im Gegensatz zu der Zeit beim Regimentsnachrichtenzug hatte ich bei der Schützenkompanie immer Hunger. Als ich einmal aus irgendeinem Grund zum Tross musste, bat ich dort um ein Brot. Der Küchensoldat sah meinen Fotoapparat und wollte diesen im Tausch gegen ein Brot haben. Ich bekam also kein Brot. Wenig später, als ich den Fotoapparat im Gepäck beim Tross gelassen hatte, ging das Gepäck durch Beschuss (angeblich) verloren.
Ich hatte in meinem Brotbeutel eine Dünndruckausgabe von Goethes Faust. Ich habe diese heute noch und man sieht, dass sie ein Loch hat. Das hat ein Granatsplitter verursacht. So hat Goethe vermutlich meinen „Heimatschuss“ verhindert.
Zu den Kameraden in der Schützenkompanie hatte ich kaum ein irgendwie persönliches Verhältnis. Für einen Analphabeten schrieb ich die Briefe an seine Frau. Dann war da Willi. Der war ganz anders. Mit dem konnte ich reden. Er strahlte etwas aus, was ihn liebenswert machte. Die Gespräche mit ihm waren mir ein rechter Trost. Den Hintergrund seiner heiteren Gelassenheit erfuhr ich dann auch. Er war sehr religiös und wollte nach dem Krieg Dominikaner werden (das wurde er dann in der Tat, trat aber schließlich wieder aus, um zu heiraten).
Im Frühsommer hatte ich meinen ersten Heimaturlaub. Als ich zurückkam, hatte unsere Division noch weit verlustreichere Kämpfe zu bestehen gehabt als im Winter. U.a. war der Regimentskommandeur gefallen, der mich verurteilt hatte. Auch Willi war nicht mehr da. Er hatte einen Heimatschuss.
Alsbald holte mich mein ehemaliger Nachrichtenzugführer zum Regimentsstab zurück. Irgendwann wurde ich zum Gefreiten „ befördert“, irgendwann zum Obergefreiten. Irgendwann wurde ich „im Namen des Führers“ mit dem Eisernen Kreuz (mit Hakenkreuz darauf) zweiter Klasse dekoriert,
irgendwann bekam ich auch das hakenkreuzverzierte Infanterie-Sturmabzeichen.

Seit Stalingrad war ich mir ganz sicher, dass der Krieg für Deutschland verloren war. Mehr und mehr konnte ich nicht verstehen, dass die militärischen Führer den aussichtslosen Kampf weiterführten. Ich fing an, die Generäle zu hassen. Die meisten meiner Kameraden haben die Russen gehasst. Die deutsche Propaganda bezeichnete sie als Untermenschen; und es hat nicht nur auf deutscher Seite sondern auch auf der gegnerischen unmenschliche Übergriffe gegeben. Ich aber sah in den russischen Soldaten genauso arme Teufel, wie wir es waren. Großes Mitleid hatte ich mit der Zivilbevölkerung, mit der wir freilich nur sehr sporadisch Kontakt hatten.
In diesem Zusammenhang sollte ich eine Szene schildern, die mich sehr beeindruckt hat. Ich war in einem kleinen Haus allein einquartiert, in dem ein älteres russisches Ehepaar wohnte. Als ich die beiden verließ, verabschiedete sich der alte Mann von mir, indem er die Arme ausbreitete und dazu offenbar etwas Religiöses sprach; es war deutlich, dass er mich segnete.
Ein Donnerbalken ist ein WC ohne Wasserspülung und ohne Brille. Es ist ein Balken statt Brille und dazu ein Erdloch. Nur der Zweck der Einrichtung ist derselbe. Und eben zu diesem Zweck saß ich 1943 auf so einem Donnerbalken. Dieser befand sich vor fremden Blicken geschützt hinter einem Bretterzaun und neben dem Holzhaus, in welchem wir Soldaten untergebracht waren. Es war dort fast friedlich; wir konnten uns sogar Hühner halten, die wir, damit sie nicht wegliefen oder nicht gestohlen wurden, unterm Fußboden einquartiert hatten. Die Idylle wurde nur hin und wieder unterbrochen durch den dumpfen Abschuss eines russischen Granatwerfers; daraufhin hörte man dann das Pfeifen der Granate und alsbald auch den Einschlag irgendwo in dem Dorf. Die Einschläge beunruhigten mich indes nicht, weil sie weit verstreut lagen man war ja allerhand Schlimmeres gewohnt. Da, plötzlich, ein Abschuss, dessen Ton mir anders schien. Mein Schutzengel oder meine Intuition meldete Alarm. Ich zog mir mitten im Geschäft die Hosen hoch und kaum hatte ich das Haus erreicht, krachte die Granate genau auf die Stelle, auf der ich soeben noch gesessen hatte. Davon habe ich dann ein Foto gemacht.

Als das Stauffenbergsche Attentat auf Hitler (20.7.1944) bekannt wurde, waren alle Kameraden erschüttert, aber es blieb verborgen, ob sie jeweils so geschockt vom Misserfolg des Attentats oder vor Abscheu gegen die Tat waren.
1944 wurde die 211. Division in Graudenz nunmehr unter dem Namen Volksgrenadierdivision neu aufgestellt, bekam neue Uniformen und musste von da an nicht wie sonst beim Militär, sondern mit gestrecktem Arm grüssen.
Von Graudenz aus kam dann der Einsatz in Ungarn.
Es war Ende 1944. Die Division lag an der Front in dem Teil der heutigen Slovakei, der auch heute noch überwiegend von Ungarn bewohnt wird. Ich sass in einem Erdloch, welches innerhalb eines zu einem Bauernhof gehörenden Areals gehörte und vermutlich der Lagerung von Kartoffeln oder anderem gedient haben mag. Ich war dabei, einen Funkspruch an den Regimentsstab durchzugeben, als mein Melder kurz zu meinem Loch hereinschaute mit der Meldung: „russische Panzer!“ . Ich morste meinen Funkspruch zu Ende und schaute aus dem Loch. Wenige Meter vor mir auf der Strasse stand ein Panzer, die Kanone in meine Richtung gedreht, mit aufgesessener Infanterie. Ich dachte: jetzt kracht`s. Es tat sich aber nichts und der Panzer fuhr dann weiter, nach ihm noch andere. Mir war klar, dass das Dorf nunmehr von Russen besetzt war. Einmal hörte ich Stimmen in der Nähe. Ich überlegte: sollte ich noch einen Funkspruch mit letzten Grüssen an meine Eltern abschicken und mich dann den Russen ergeben? Ein Blick auf die Uhr zeigte, dass es alsbald dunkel werden müsste. Ich entschloss mich, zu versuchen, mich Richtung Westen (einen Kompass hatte ich immer bei mir) abzusetzen und als es dunkel war, schnallte ich das 40 Pfund schwere Funkgerät über und marschierte vorsichtig los. Die weite Ebene war schwach beleuchtet durch ein in der Ferne brennendes Haus. Nach einiger Zeit grosser Angst war die Entfernung von dem Dorf so grosss geworden, dass ich mich gerettet fühlte. Ich hatte die Feldflasche voll Rotwein und in dem Gefühl meiner grossen Erleichterung trank ich die Flasche in einem Zug aus. Alsbald erreichte ich eine deutsche Stellung einer 8,8 cm FlakBatterie. Das Funkgerät bewahrte mich davor, sofort in die nächste Infanteriestellung eingereiht zu werden. Ich fand schliesslich meine Einheit wieder wobei ich es bei der Suche nicht besonders eilig hatte. Von dem zweiten Funktrupp, der beim Nachbarbataillon abgestellt gewesen war, fehlte jede Spur. Gefallen oder Gefangenschaft!
Meinen letzten Heimaturlaub bekam ich im Dezember 1944 und erlebte einen Bombenangriff auf meine Heimatstadt, die dabei zu zwei Dritteln zerstört wurde. Meinen Vater sehe ich noch mit dem Ohr nahe am „Volksempfänger“. Er hörte London. Manchmal wurde er dann richtig wütend und meinte, er würde diesen Kerl (Hitler) eigenhändig umbringen, wenn er nur eine Gelegenheit dazu hätte. Dass meine Eltern von den grauenhaften Geschehnissen in den KZs etwas wussten, glaube ich nicht. Und ich habe davon auch nichts gewusst. Und wenn ich davon ein Gerücht gehört hätte, hätte ich es nicht geglaubt. Vermutlich hat man meine Eltern absichtlich von den wie ich später erfuhr ansonsten gerüchtweise wohl verbreiteten Schreckensnachrichten verschont.
Bei der Rückfahrt an die Front saß in meinem Eisenbahnabteil ein ganz junger SSSoldat. Im Gespräch machte er Andeutungen von furchtbaren Erlebnissen. Er sagte noch, dass er sich schämen müsse, zur SS zu gehören. Aber er wollte mir nicht sagen warum.
Eines Tages ich war wieder an der Front und für die Nacht war wieder „eine Frontbegradigung“, also ein Rückzug geplant, bekamen wir den Befehl, alle Häuser eines Dorfes anzuzünden, angeblich um Schussfeld frei zu machen. Da habe ich auch so ein strohgedecktes Holzhaus in Flammen aufgehen lassen. Als ich dann aber erfahren musste, dass derselbe Befehl bei jedem weiteren Rückzug ausgegeben wurde, habe ich die Unmenschlichkeit des Prinzips der verbrannten Erde erkannt und mich nicht mehr daran beteiligt, was freilich kein einziges Haus gerettet hat.

Im April 1945 war unsere Division praktisch nicht mehr existent. Sie war aufgerieben, die meisten Soldaten waren gefallen oder verwundet oder in Gefangenschaft geraten. Aber der Nachrichtenzug, zu dem ich gehörte, war noch einigermaßen funktionsfähig. Da wurden wir einer SSDivision unterstellt. Zu meinen vielen Ängsten kam noch die dazu, dass ich womöglich in Gemeinschaft mit den SSLeuten in russische Gefangenschaft geriet.
Es wurde immer deutlicher, dass der Krieg in Kürze zu Ende gehen würde. Da entschloss ich mich, mich in Richtung Westen abzusetzen. Wir waren nordwestlich von Wien. Die Amerikaner waren schon weit in Deutschland eingedrungen. Ich wollte mich bis zu ihnen durchschlagen. Eine Landkarte Österreichs hatte ich irgendwo einem Schulatlas entnommen und einen Kompass besaß ich sowieso. Eines Tages bekam ich den Befehl, ein Funkgerät zur Reparatur zu bringen. So kam ich zu einem Marschbefehl, mit dem ich ganz legal ein gutes Stück hinter die Front gelangen konnte. Ich bekam ein Fahrrad, hatte eine Maschinenpistole und eine Pistole. Das Funkgerät habe ich ordnungsgemäß abgeliefert. Dann bin ich zu einem Bauernhof gefahren, wo wir einige Zeit vorher einquartiert gewesen waren und wo ich mich in die Tochter verliebt hatte. Die guten Leute gaben mir einen Lebensmittelvorrat mit auf den Weg. Ihren Wunsch, die Tochter mit in den Westen zu nehmen, habe ich den verängstigten Eitern (es waren deutsche Bauern, die vor ihren tschechischen Landsleuten sehr berechtigte Angst hatten) vernünftigerweise ausschlagen müssen.
Noch war ich nicht vom legalen Weg abgekommen. Aber dann stand ich vor der militärisch bewachten Brücke über die Thaia. Ich bin unbehelligt hinüber gefahren und damit war ich endgültig auf der anderen Seite: vogelfreier Deserteur, zum Tode verurteilt! Aber ich war frei und hatte die Hoffnung, bald wieder zu Hause bei meinen Eltern zu sein. Das Fahrrad und die Maschinenpistole habe ich alsbald irgendwo liegen gelassen. Ich marschierte nur nachts. Ich orientierte mich mit Hilfe der Landkarte und des Kompasses.
Nachdem ich ein paar Nächte nur querfeldein, vorzugsweise durch Wälder, gewandert war und alles so glatt lief wurde ich leichtsinnig und ging auf einer Straße, erreichte ein Dorf in der irrigen Meinung, dass nachts um 3 Uhr alles schlafen würde. Plötzlich stand vor mir ein sogenannter Kettenhund, also ein Feldgendarm. Der fragte mich nach einem Marschbefehl und legte alsbald seine Hand auf meine Schulter und verkündete mir: “Sie sind verhaftet!“ Ich versuchte sofort, zu fliehen. Als der Mann mich festhalten wollte, hatte ich schon meine Pistole entsichert; er war wohl ebenso überrascht wie ich; jedenfalls gelang es mir, mich seinem Zugriff zu entreissen ohne dass ich schießen mußte, was ich aber ohne Zögern getan hätte, wenn ich denn nicht anders hätte frei kommen können. Ich lief so schnell ich konnte aus dem Dorf hinaus, während der Feldgendarm lauthals die Wache alarmierte. Als ich aus dem Dorf heraus war, ganz außer Atem, versteckte ich mich abseits in einem Gebüsch. Die Wache fuhr alsbald auf der Straße zum Dorf hinaus mit aufgeblendeten Scheinwerfern. Als das Auto dann zurückgekehrt war, entkam ich endgültig. Freilich hatte ich bei dem Handgemenge die Tasche mit meinen Lebensmitteln verloren, ebenso meine Kopfbedeckung. Ich besaß aber zum Glück noch die Landkarte und den Kompass.
So kam ich ein Stück weiter im niederösterreichischen Gebirge südlich Gmünd. Dabei hatte ich zunächst immer Angst, doch noch verfolgt zu werden. Schließlich gönnte ich mir ein paar Stunden Halbschlaf auf einem JägerHochstand. Es fing an zu schneien, ich fror und der Hunger meldete sich mit aller Macht; hatte ich doch in all den Tagen meiner Flucht nur ganz wenig gegessen, weil ich ja nicht wußte, für wie lange meine Vorräte reichen mussten. Es war klar: Lebensmittel konnte ich nur von Menschen erhalten; und diese mußte ich doch am meisten fürchten. Es blieb mir aber keine andere Wahl, als an irgendeine einsame Haustür zu klopfen. Die Leute gaben mir aber nichts; sie durchschauten meine Lage und hatten Angst.
Ich war nahezu verzweifelt. Als ich mich einem kleinen Dorf näherte, sah ich, dass sich Soldaten dort aufhielten. Mir fiel auf, daß sie nicht die Uniform der Wehrmacht trugen. Ich schlich mich heran, bis ich verstehen konnte, in welcher Sprache sie redeten. Das war zu meiner Überraschung deutsch und schließlich begriff ich, daß es sich um Deutschungarn handelte. lch überlegte einen Moment, daß diese Menschen mit dem Krieg und den Nazis nichts mehr im Sinn haben konnten und fasste daher den Mut, zu ihnen zu gehen und ihnen offen meine Situation zu schildern. Ich bekam sofort etwas zu essen und weil ich gar so abgerissen aussah, meinten die guten Menschen, ich müsse unbedingt wenigstens eine Nacht bei ihnen ruhen. Ich fasste Vertrauen und schlief dann gut bei ihnen in der Scheune, die Pistole unter meinem Kopf.
Als ich am andern Morgen weiterziehen wollte, meinten meine Gastgeber, daß ich das vorerst lieber lassen sollte, weil nämlich SSEinheiten die Wälder der Umgebung durchkämmten und alle Deserteure am nächsten Baum aufknüpfen würden. So blieb ich also und damit ich mich nicht verstecken mußte, gaben sie mir eine ungarische Uniform. So konnte ich mich frei bewegen und war relativ sicher.
In einer der nächsten Nächte gab es plötzlich großen Lärm; es war Alarm. Den Ungarn war befohlen worden, mit ihren Kanonen nach Norden in die Tschechei zu stoßen; dort sei ein Aufstand ausgebrochen; den gelte es niederzuwerfen. Ich solle mit ihnen kommen oder beiben.
Ich blieb und schlief bis zum andern Morgen. Als ich aufwachte, lag neben mir Zivilkleidung. Ich habe nie erfahren, wer mir die dahin gelegt hat, die Ungarn oder etwa der Bauer, auf dessen Hof die Scheune lag. Dieser Bauer, der sich die ganze Zeit über nicht hatte blicken lassen, kam an diesem Morgen zu mir und verkündete, es sei Waffenstillstand. Es war der 8. Mai 1945. Der Tag der Befreiung!!!
Die Amerikaner waren auf Linz vorgestoßen. Bis dahin waren es nur einige zehn Kilometer. Bevor ich mich auf den Weg machte, lud mich der Bauer zum Mittagessen ein. Es gab Sauerbraten und Knödel. Danach marschierte ich los. In Prägarten bei Linz passierte ich bewaffnete ehemalige französische Gefangene, dann auch amerikanische Posten. Der weitere Heimweg war im Vergleich zur Dramatik des ersten Teils fast eine Vergnügungsreise, auch wenn diese durch eine dreitägige amerikanische Gefangenschaft in Ochsenfurt unliebsam unterbrochen wurde. Ein Stück des Weges ging ich gemeinsam mit einem Mann, der erzählte, Gefangener des KZ's Mauthausen gewesen zu sein; er stammte aus dem Ruhrgebiet und war dort als Kommunist verhaftet worden. Ich weiß nicht mehr, was er mir aus seiner KZZeit erzählt hat; das volle Ausmaß der schrecklichen Unmenschlichkeiten, die in den Lagern passiert sind, habe ich jedenfalls erst später erfahren. Ich war Zeuge, wie ein Mann in deutscher Uniform von amerikanischen Soldaten das Steilufer der Donau hinunter geworfen wurde; er rührte sich nicht mehr. Als ich einen der amerikanischen Soldaten daraufhin ansprach ich war entsetzt, weil ich den Amerikanern so etwas nicht zugetraut hatte , erhielt ich nur zur Antwort, dass der Mann bei der SS gewesen sei.
Anfang Juni kam ich zu meinen Eltern zurück. Ich war glücklich, endlich frei und außer Gefahr zu sein. Die Besatzungssoldaten sah ich als Befreier an. Allerdings ärgerte es mich, daß die Engländer in meiner Heimatstadt die Passanten verpflichteten die Fahne Grossbritanniens durch Hut abnehmen zu grüßen. Zwar konnte man sich dem entziehen, indem man den Hut schon lange vor dem Passieren unter den Arm klemmte. Es war sinnlose Schikane. In der Sylvesternacht 45/46 habe ich zusammen mit einem Freund eines der die Demütigung anordnenden Gebotsschilder geraubt, mit nach Hause genommen und in der Heizung verbrannt. Gott sei Dank sind den Engländern die Urheber des Delikts nicht bekannt geworden.
Einige Zeit später versicherte mir ein ehemaliger Offizier, der es wissen musste, dass man mich und meinesgleichen, hätten denn die Nazis den Krieg gewonnen, im Rahmen der „Endlösung“ auch noch umgebracht hätte.
**************
Kommentare (18)
floravonbistram
sind die Berichte der Zeitzeugen, denn nur so erfahren wir Nachkriegs"kinder" von Geschehnissen, die in der Schule übergangen wurden.
Mein Vater erzählte nie vom Krieg und der Gefangenschaft, aus der er 1948 zurückkam, doch ich habe noch seine Schreie in den Ohren, wenn er von meiner Mutter aus furchtbaren Träumen geweckt werden musste. Nur von dem unerträglichen Hunger sprach er, nachdem ich einmal eine Scheibe Schulbrot weggeworfen und dafür eine Tracht Prügel bezogen hatte.
Später erzählten meine Patin und meine Oma auf meine Fragen hin, was sie und Angehörige erlebt hatten
Danke für Deinen Bericht
Flo
Mein Vater erzählte nie vom Krieg und der Gefangenschaft, aus der er 1948 zurückkam, doch ich habe noch seine Schreie in den Ohren, wenn er von meiner Mutter aus furchtbaren Träumen geweckt werden musste. Nur von dem unerträglichen Hunger sprach er, nachdem ich einmal eine Scheibe Schulbrot weggeworfen und dafür eine Tracht Prügel bezogen hatte.
Später erzählten meine Patin und meine Oma auf meine Fragen hin, was sie und Angehörige erlebt hatten
Danke für Deinen Bericht
Flo
Ela48
mich hat dieser Bericht sehr aufgewühlt. Ich bin Jahrgang 1948 und habe in den letzten 20 Jahren viel erfahren wollen, was mit Hitler, Juden, Konzentrationslager, zweiter Weltkrieg auf sich hatte.
Der Geschichtsunterricht in der Schulzeit versorgte mich und andere mit minimalen Informationen.
Ich danke Dir. Deinen Bericht habe ich auch weitergeleitet.
lieber Gruß, Ela
Der Geschichtsunterricht in der Schulzeit versorgte mich und andere mit minimalen Informationen.
Ich danke Dir. Deinen Bericht habe ich auch weitergeleitet.
lieber Gruß, Ela
florian
bin ich, nach sorgfältiger Lektüre.
Vielen Dank, dass wir teilhaben durften!
Beste Grüße, Florian
Vielen Dank, dass wir teilhaben durften!
Beste Grüße, Florian
Karl
Udos Bericht gehört zu den wertvollsten Schätzen im Seniorentreff. Ich möchte hier an einen ähnlich erschütternden Lebensbericht erinnern, an den von Peter Kurtenbach, der noch ein Buch aus seinen Texten machen konnte. Zeitzeugen aus Kriegs- oder Vorkriegszeiten helfen uns, das Entstehen ähnlicher Verhältnisse rechtzeitig zu erkennen und gegenzusteuern, Karl
stefanie
Ich las Deinen Bericht erst heute(4.8.2o11)Er hat mich sehr aufgewühlt und ich bin auch dankbar,daß Du Dir die Mühe gemacht hast,Deine Vergangenheit ausführlich zu erzählen.Es ist wichtig,daß Berichte von Zeitzeugen damals,heute gehört werden.
Herzlichst stefanie
Herzlichst stefanie
ehemaligesMitglied42
dein bericht hat mich aufgewühlt. man merkt aus deinen worten wie nah diese erlebnisse dir heute noch sind.Habe mich viel mit der zeit 1933-1945 beschäftigt, hat diese doch nicht nur deutschland , sondern die welt verändert.
Danke dir, für den bericht und verneige mich vor den vielen menschen egal welcher nation, die unter diesem regim der Sa und SS zu leiden hatten.
Es muss immer wieder dran erinnert werden, die deutschen waren zuerst die, die die anderen nationen überfielen, alles was danach kam, war oft nicht zu akzeptieren aber verständlich.
Danke dir , LG Anne
Danke dir, für den bericht und verneige mich vor den vielen menschen egal welcher nation, die unter diesem regim der Sa und SS zu leiden hatten.
Es muss immer wieder dran erinnert werden, die deutschen waren zuerst die, die die anderen nationen überfielen, alles was danach kam, war oft nicht zu akzeptieren aber verständlich.
Danke dir , LG Anne
luchs35 †
Es ist so wichtig, dass Zeitzeugen, die ja immer weniger werden, über diese Jahre erzählen. Junge Menschen können dann vieles besser verstehen, vielleicht auch lernen. Vieles aus deiner Geschichte habe ich auch in den Kriegstagebüchern meines Bruders, der sein Leben als Zwanzigjähriger bei der Normandie- Invasion verlor, gelesen. Ihn selbst konnte ich leider nur aus den Erzählungen meiner Eltern kennenlernen.
Ich empfinde Trauer über den auch geistigen Missbrauch der jungen Menschen aus jener Zeit.
Lieber Gruss
Luchs
Ich empfinde Trauer über den auch geistigen Missbrauch der jungen Menschen aus jener Zeit.
Lieber Gruss
Luchs
lifong2007
gerade habe ich Deinen Bericht gelesen, der mir die Kriegsjahre und meine Kindheit in Erinnerung brachte. Was waren das für unruhige Zeiten, Und was mußtest Du als kleiner Junge und später alles erleben. Deine Ausführungen haben mich sehr berührt und auch Tränen flossen auch in Zusammenhang mit einigen eigenen Erlebnissen. Aber zum Glück hast Du alles gut überstanden. Ich werde Deine Ausführungen nochmals lesen. Jetzt, wo wir schon über 6o Jahre Frieden in Europa haben, ist es ganz wichtig, die Kriegsjahre nicht zu vergessen. Was Menschen sich so alles antun können! Möge so etwas nie wieder passieren.
Nun wünsche ich Dir und Deiner lieben Frau einen schönen 3. Advent. Alles Liebe lifong2007
Nun wünsche ich Dir und Deiner lieben Frau einen schönen 3. Advent. Alles Liebe lifong2007
ika1 †
Ich habe mit viel Interesse deinen Bericht gelesen.
Es ist eine traurige Geschichte und war es eine traurige Zeit.
Ich fühlte mich voll in meine Kindheit versetzt , auch wir hatten wie manche
andere dir hier geschrieben haben Jüdische Verwande.
Aber du wirst mir sicher recht geben es gab auch aufrechte mutige Menschen
dazu gehörte mein Vater .
Nach deinen Bericht hier bin ich noch sehr stolz auf ihn
Ich wünsche dir alles gute ein Besinnliches Weihnachtsfest
Ika1
Es ist eine traurige Geschichte und war es eine traurige Zeit.
Ich fühlte mich voll in meine Kindheit versetzt , auch wir hatten wie manche
andere dir hier geschrieben haben Jüdische Verwande.
Aber du wirst mir sicher recht geben es gab auch aufrechte mutige Menschen
dazu gehörte mein Vater .
Nach deinen Bericht hier bin ich noch sehr stolz auf ihn
Ich wünsche dir alles gute ein Besinnliches Weihnachtsfest
Ika1
Karl
Bei Wikipedia ist Udos Lebensbericht nun unter Literatur auf der Seite jüdische Mischlinge verlinkt
Karl
Als Hintergrund zu Udos Bericht möchte ich hier zu den"Nürnberger Gesetzen" bei Wikipedia verlinken.
Die Nürnberger Gesetze, auch Nürnberger Rassengesetze genannt, wurden am 15. September 1935 anlässlich des 7. Reichsparteitags der NSDAP („Reichsparteitag der Freiheit“) in Nürnberg vom Reichstag angenommen und vom damaligen Reichstagspräsidenten Hermann Göring feierlich verkündet.Mit diesen Gesetzen wurde die menschenverachtende Politik der Nazis scheinlegitimiert.
nasti
mein deutsche Eheman war älter als ich, und ein unfreiwilliger Naziboy, 5 Jahre lang in amerikanischen Gefangenschaft.
Hat mir auch sehr viel erzählt über alles, ich persönlich erinnere mich an deutsche Soldaten welcher hausierten in unserem Haus in Südslowakei, wo alle sprachen ungarisch.
Mein Großvater mochte die deutsche sehr, nachdem kamen die Russische Soldaten zu uns mit wilde und brutale Gewohnheiten. Aber sie waren auch gutmutige Menschen, ein russische Arzt rettete das Leben meines klienes Bruders, Ihn war eine Rippe mit OP abgenommen , und das Wund erzündete sich.
Kann es sein das du in unserem Haus einqartiert wars? *g* Nichts ist unmöglich. Dein Gesicht als Soldat kommt mir sehr bekannt vor, ich als 3 Jährige beobachtete die Soldaten mit eine Verliebtheit.
Nasti
Grüßt Nasti
Hat mir auch sehr viel erzählt über alles, ich persönlich erinnere mich an deutsche Soldaten welcher hausierten in unserem Haus in Südslowakei, wo alle sprachen ungarisch.
Mein Großvater mochte die deutsche sehr, nachdem kamen die Russische Soldaten zu uns mit wilde und brutale Gewohnheiten. Aber sie waren auch gutmutige Menschen, ein russische Arzt rettete das Leben meines klienes Bruders, Ihn war eine Rippe mit OP abgenommen , und das Wund erzündete sich.
Kann es sein das du in unserem Haus einqartiert wars? *g* Nichts ist unmöglich. Dein Gesicht als Soldat kommt mir sehr bekannt vor, ich als 3 Jährige beobachtete die Soldaten mit eine Verliebtheit.
Nasti
Grüßt Nasti
tilli †
Lieber Udo- gut,das die Jugend von Heute ,keinen Krieg mehr erleben muss.
Mein Vater hatte schweres erlebt.War 10 mal verwundet Überlebte Stalingrad.
Mit deinen Erinnerungen, wurden in mir die Geschichten wach ,die mein Vater erzählte.
Udo ich danke dir, das du dich entschlossen hast, von dieser Zeit zu erzählen. Jedem muss bewusst sein, wie gut uns jetzt geht.
Ich grüsse dich in dieser besinnlichen Zeit.
Tilli
Mein Vater hatte schweres erlebt.War 10 mal verwundet Überlebte Stalingrad.
Mit deinen Erinnerungen, wurden in mir die Geschichten wach ,die mein Vater erzählte.
Udo ich danke dir, das du dich entschlossen hast, von dieser Zeit zu erzählen. Jedem muss bewusst sein, wie gut uns jetzt geht.
Ich grüsse dich in dieser besinnlichen Zeit.
Tilli
ladybird
ist Deine Geschichte,weil sie ein Stück Deines Lebens ist, Du bist die Generation meiner Eltern, von ihnen habe ich auch viele Erzählungen dieser Zeit, jeder hat eine eigene.Mehrmals bekam ich Gänsehaut und Tränen brachen aus. Mit Dank für Deinen Bericht und Bewunderung für Eure Generation,herzlichst Renate
marianne
und bin froh, dass du jetzt auch in diesem Forum bist!
Mein Mann und ich, in den Dreissigern geboren, haben Verwandte und Bekannte deines Alters.
Wie oft sagten wir schon: es ist beinahe so, als ob eine Generation zwischen uns und euch läge..., nicht nur ein Jahrzehnt.
So bald ich mehr Ruhe habe, lese ich deinen Bericht nochmals.
Es grüßt
Marianne
Mein Mann und ich, in den Dreissigern geboren, haben Verwandte und Bekannte deines Alters.
Wie oft sagten wir schon: es ist beinahe so, als ob eine Generation zwischen uns und euch läge..., nicht nur ein Jahrzehnt.
So bald ich mehr Ruhe habe, lese ich deinen Bericht nochmals.
Es grüßt
Marianne
Linta †
Mit Tränen in den Augen sage ich : Dank, einfach nur Dank
Diese Deine Erinnerung geht mir unter die Haut.
ninna
Mit Tränen in den Augen sage ich : Dank, einfach nur Dank
Diese Deine Erinnerung geht mir unter die Haut.
ninna












Ich habe diesen Bericht erst heute gefunden. Er hat mich zutiefst berührt und mir in manchen Details klar gemacht, was mein Vater in der Hitlerzeit und im Krieg erlebt haben muss.
Über seine Erlebnisse sprach er nie, aber ich weiß, dass er, da er dunkelhaarig und fast schwarz-braune Augen hatte, zu seiner Hochzeit einen Ariernachweis erbringen musste, um unsere überaus blonde Mutter heiraten zu dürfen.
Als er im Alter von 54 Jahren an Parkinson erkrankte, ereilten ihn immer wieder schreckliche Träume von den Erlebnissen im Krieg, den er als Sanitäter mitmachen musste. Auch er wäre vermutlich - von deutschen Soldaten zum Ende des Krieges vielleicht erwischt - standrechtlich erschossen worden, weil er über Österreich in die Heimat geflüchtet war. Das Erleben vieler Gräueltaten im Krieg, wo er hatte helfen wollen, es ihm aber verboten wurde, hat er nie verwunden. Es quälte ihn bis zu seinem Tod als 76-Jähriger.
Danke lieber Udo für Deinen Bericht! So kann ich ein wenig besser meinen Vater nachträglich verstehen.
nnamttor44 - Uschi